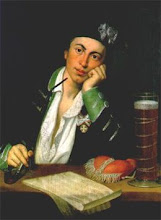Vorgestern (22. Mai) ergab sich für mich wieder einmal recht spontan die günstige Gelegenheit, ein Konzert des Gürzenich-Orchesters in der Kölner Philharmonie zu besuchen. Vor fast ausverkauftem Haus wurde folgendes Programm geboten:
Franz Schubert (1797-1828)
Sinfonie h-moll D 759 „Die Unvollendete“
Julian Anderson (geb. 1967)
„Symphony“
Johannes Brahms (1833-97)
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 d-moll op. 15
Lars Vogt, Klavier
Gürzenich-Orchester Köln
Markus Stenz, Dirigent
Ein attraktives Programm mit gleich zwei absoluten „Konzertklassikern“ – das zog sichtlich viele Interessenten an!
Ich muss allerdings sagen, dass ich mit der Interpretation von Schuberts h-moll-Sinfonie, die ja nach wie vor den nahezu unverwüstlichen, weil so herrlich griffigen Titel „Die Unvollendete“ trägt, nicht so ganz glücklich war.
Das Tempo, das Markus Stenz seinem Orchester gerade im berühmten ersten Satz vorgab, fand ich ein bisschen zu schnell. Irgendwie konnten die gesanglich-romantischen Stellen sich dadurch nicht so richtig entfalten – gerade das ist meiner Meinung nach aber wichtig, um die schroffen Gegensätze zwischen lyrischen und dramatisch-ernsten Passagen, die die gesamte Komposition durchziehen, besonders wirkungsvoll gegeneinander abzusetzen.
So blieb – jedenfalls für mein Empfinden – doch einiges an romantisch-lyrischem Potential auf der Strecke, stattdessen herrschte ein eher „sportlich-schlanker“ Klang vor, den ich teils auch rau oder sogar schroff empfand – und dies wohlgemerkt nicht nur in den düsteren Passagen!
Das Ganze erinnerte mich ein bisschen an die seit einiger Zeit bei der Interpretation von Beethoven-Sinfonien ziemlich verbreitete Herangehensweise (ich polemisiere hier ein bisschen): Zügige Tempi, aufgeraut bis schroff zu nennender Orchesterklang, möglichst stürmisch-rebellischer Gesamteindruck. Ob das, was für Beethoven ja seine Daseinsberechtigung haben mag, auch bei Schubert funktioniert? Ich bin mir da nicht so sicher…
Die Interpretation des zweiten Satzes gefiel mir dann jedenfalls deutlich besser - vielleicht, weil man ihn nicht so unmittelbar im Ohr hat, wie den ungleich bekannteren ersten Satz?
An der spielerischen Leistung des Gürzenich-Orchesters gab es immerhin – wie gewohnt – nichts auszusetzen.
Das gesamte Programm des Abends stand unter dem Motto Drei Anläufe zur Gattung „Sinfonie“ und tatsächlich handelt es sich ja bei der in ihrer Zweisätzigkeit für die Entstehungszeit 1822 recht ungewöhnlich konzipierten „unvollendeten“ Sinfonie um eine Komposition, deren künstlerische Aussagekraft Schubert, nachdem er einige Skizzen für einen möglichen dritten Satz wieder verworfen hatte, offenbar so für ausreichend erachtete. Bei der Uraufführung, die dann auch erst über 40 (!) Jahre später stattfand, schien das Publikum dies auch so zu sehen – die Musikgeschichte hatte sich aber zwischenzeitlich auch schon weiterentwickelt und zu einer Zeit, wo längst Orchesterwerke in völlig freien Formen (meist unter dem Titel „Sinfonische Dichtung“) in den Konzertsälen aufgeführt wurden, war es für das Publikum offensichtlich kein Problem mehr, eine Sinfonie als vollgültig zu akzeptieren, auch wenn sie nur 2 statt der üblichen 4 Sätze aufwies. Der unselige Titel „Unvollendete“ kam dann wohl erst um 1900 auf und ist seitdem untrennbar mit diesem Werk verbunden, wird ihm aber (wie übrigens viele dieser in der Regel meist ohne Wissen oder Zustimmung der Komponisten zustandegekommenen Werktitel) nicht gerecht.
Auch der in Großbritannien seit einigen Jahren recht bekannt gewordene Komponist Julian Anderson hat in den Jahren 2002-2003 ein als „Symphony“ betiteltes, etwa 18-minütiges, einsätziges Orchesterstück geschaffen und sich damit auf seine Weise mit dieser altehrwürdigen Gattung auseinandergesetzt.
Ich finde es immer sehr spannend, wenn man auch einmal persönliche Äußerungen eines Komponisten zu seinen Werken mitbekommen kann (ein Umstand, der ja in klassischen Sinfoniekonzerten aus naheliegenden Gründen eher selten ist) und so war es sehr zu begrüßen, dass Julian Anderson im Rahmen der Konzerteinführung im Foyer der Philharmonie ein paar Erläuterungen zu seiner in deutscher Erstaufführung gespielten „Symphony“ abgab.
Er entschied sich demnach erst recht spät zu dieser Werkbezeichnung, während er für gewöhnlich etwas sprechendere Titel für seine Kompositionen auswählt. Da jedoch die Grundidee dieses Stücks, der etappenweise Übergang von völliger Erstarrung und Ruhe zu immer stärkerer Bewegung und Klangfülle eine recht abstrakte war, entschloss er sich, auch einen abstrakten, eher „technischen“ Begriff für die Komposition zu wählen. Eigenem Bekunden zufolge geht er derzeit nicht davon aus, noch eine weitere Sinfonie zu komponieren. Es handelt sich also innerhalb seines Oeuvres um einmalige Koppelung von Komposition und Titel, der hier also nicht als bloße Gattungsbezeichnung verstanden werden soll, die nach Bedarf dann auch durchnummeriert werden könnte.
Auch wenn sich mir das Werk insgesamt – wohlgemerkt nach lediglich einmaligem Hören – nicht wirklich erschlossen hat (vor allem fand ich es, nachdem ich mich vorab mit dem Konzept der Komposition beschäftigt hatte, in der letztendlichen Umsetzung nicht konsequent bzw. stringent genug, sondern viel zu episodenhaft und uneinheitlich, was den Spannungsbogen angeht), so gab es schon einige wirklich schöne und interessante Momente – was zum Beispiel das Erzeugen ungewöhnlicher Orchesterklangeffekte angeht, so versteht Mr. Anderson sein Handwerk!
Und es ist natürlich immer wieder interessant zu erleben, wie ein groß besetztes Sinfonieorchester (noch dazu ausstaffiert mit jeder Menge verschiedenster Schlaginstrumente) so richtig in voller Aktion Musik macht! Gerade bei Werken wie diesem, wo man als einzelner Musiker mitten im wildesten Getümmel (und gerade zum Schluss hin ging es hoch her!) ja keine wirklichen Orientierungspunkte hat und sich sehr konzentrieren muss, um alle Einsätze pünktlich hinzubekommen, ist das eine wirklich respekteinflößende Leistung – genau wie die des Dirigenten: Auch Markus Stenz bewahrte stets den Überblick und führte sein Orchester mit bewundernswert ruhigen und deutlichen Gesten durch dieses wirklich nicht leicht zu spielende Werk!
Nach der Pause gab es dann mit dem 1. Klavierkonzert von Johannes Brahms noch einen weiteren Klassiker – hier gefielen mir die Herangehensweise und die Interpretation deutlich besser als beim Schubert!
Auch Brahms hat ja lange künstlerisch mit sich gerungen, bevor er im Jahr 1876 dann tatsächlich seinen sinfonischen Erstling zur Uraufführung bringen konnte (der dann allerdings wie ein Befreiungsschlag auf ihn wirkte, so dass seine 2. Sinfonie bereits ein Jahr später entstand!) – auch sein 1. Klavierkonzert (uraufgeführt 1859) gehört in diesen sinfonischen Entstehungsprozess mit hinein (was man dem Werk wie ich finde auch anhört – zumindest der erste Satz war wohl auch kurzzeitig vom Komponisten als Sinfoniesatz konzipiert worden) und somit passte dieser dritte und letzte Programmpunkt des Abends gut zu dem oben erwähnten thematischen „roten Faden“.
Der sympathische Solist Lars Vogt hatte mit diesem wirklich monströsen Konzert, das mit am Beginn der Epoche der Spätromantik steht (die ja für in jeder Hinsicht groß dimensionierte Werke eine geradezu typische Ära ist), eine auch körperlich ganzen Einsatz erfordernde Mission vor sich, die er souverän bewältigte! Ich versuche mir anstelle unseres kraftvoll agierenden Solisten eine dieser elfengleichen jungen Pianistinnen aus Asien vorzustellen, die ja immer mal wieder für großen Presserummel sorgen – ob so jemand den Vortrag dieses Konzert wohl überleben würde…? *grins*
In einer so mitreißenden Interpretation wie der in diesem Konzert zu hörenden ist das 1. Klavierkonzert von Brahms eine sichere Bank (zumal Lars Vogt es verstand, nicht nur den kraftvollen Abschnitten sondern eben auch den reichlich vorhandenen lyrischen Passagen den richtigen Tonfall zu verleihen – das Konzert besteht ja bei Weitem nicht nur aus virtuosem Tastengedonner!) und so war der Schlussapplaus dann auch entsprechend frenetisch! Ein toller Abschluss eines abwechslungsreichen Konzertabends!
Posts mit dem Label Konzert werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Konzert werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Donnerstag, 24. Mai 2012
Donnerstag, 29. März 2012
Philharmonie-Konzert
Vorgestern, also am 27.03., hatte ich erfreulicherweise wieder einmal Gelegenheit, ein Konzert des Gürzenich-Orchesters in der Kölner Philharmonie besuchen zu können.
Das Programm des Abends sah wie folgt aus:
Jörg Widmann (geb. 1973)
„Elegie“ für Klarinette und Orchester
Anton Bruckner (1824-96)
Sinfonie Nr. 9 d-moll
Jörg Widmann, Klarinette
Gürzenich-Orchester Köln
Dir.: Simone Young
Man hat nicht so häufig die Gelegenheit, im Rahmen eines „klassischen“ Sinfoniekonzerts ein Stück zu hören, das von seinem Komponisten selber vorgetragen wird. In diesem Zusammenhang ein komischer Gedanke, wenn man sich vorstellt, das so etwas im 18. und 19. Jahrhundert mehr die Regel als die Ausnahme darstellte…
Ich fand es ausgesprochen interessant (und keinesfalls selbstverständlich), dass sich Jörg Widmann im Rahmen der Konzerteinführung im Foyer kurz vor Konzertbeginn noch persönlich zu seiner Komposition äußerte und auch die speziellen technischen Schwierigkeiten und Herausforderungen erklärte, die er dem Klarinettenpart in seiner knapp 20-minütigen Elegie zugedacht hat.
Dieses Stück, eine Auftragskomposition des NDR aus dem Jahr 2006, wollte der sympathische Münchner nicht unbedingt nur als das verstanden wissen, was man beim Werktitel „Elegie“ spontan erwarten würde, nämlich einen getragenen melancholischen Klagegesang. Für Widmann spielen in diesen „Elegie“-Begriff auch noch einige andere Facetten mit hinein, die sich in dem Stück, das aus vielen kleineren, ganz unterschiedliche Stimmungen transportierenden Episoden besteht, dem Zuhörer mitteilen.
Als roten Faden des Werks könnte man die Widmann offenbar sehr faszinierende „höchstmögliche Differenzierung des Einzeltons“ bezeichnen – lange ausgehaltene Töne des Soloinstruments schweben über der Orchesterbegleitung und werden durch Triller, die Erzeugung von Mehrfachklängen aus der Obertonreihe oder chromatischen Bewegungen, die bis in den Vierteltonbereich vorstoßen, stets neu umgefärbt und variiert. Klanglich interessant war auch die Mitwirkung von Harfe, Celesta und Akkordeon im Orchester – gerade die Akkordeonklänge mischten sich teilweise so perfekt mit den Klarinettentönen, dass man gar nicht wusste, welches der beiden Instrumente gerade spielte.
Auch wenn mir persönlich das Stück (zumindest nach nur einmaligem Hören) nicht wirklich zugesagt hat, da es mir im Ganzen doch etwas zu unruhig und episodenhaft war und mir durch die erwähnte Kleinteiligkeit die große Linie fehlte, die ich persönlich für eine „Elegie“ schon erwartet hätte (wobei es natürlich durchaus die Absicht des Komponisten gewesen sein könnte, auch diese Erwartungshaltung zu durchbrechen), so muss ich dem Solisten Jörg Widmann doch großen Respekt zollen:
Er schaffte es, seinem Instrument Töne zu entlocken, die ich bislang noch nie von einer Klarinette zu hören bekommen habe! Da schnarrte und knarzte es ausgiebigst, an manchen Stellen klang die Klarinette fast schon wie das aus ihr hervorgegangene Saxofon und die Tatsache, dass der Solist seinem Instrument mehrere Töne gleichzeitig entlocken konnte, fand ich auch faszinierend! Solche „mitkieksenden“ Obertöne treten – vom Spieler in der Regel nicht kontrollierbar – bei der Klarinette ab und an auf (ich habe das in der Praxis oft genug mitbekommen) und ich stelle es mir sehr schwierig vor, solche „Zufallstöne“ quasi auf Kommando hervorzubringen. Da beherrscht jemand sein Instrument wirklich meisterhaft!
Nach der Pause folgte dann die gut einstündige 9. Bruckner-Sinfonie. Simone Young hatte für ihre Wiedergabe – wie in der Regel bei allen Bruckner-Sinfonien, die sie bislang dirigiert und auch schon auf Tonträger eingespielt hat - die Notentext-Urfassung des Komponisten gewählt. Gerade bei Bruckner-Kompositionen wimmelt es ja oft von Revisionsfassungen, Umstellungen, neu komponierten Teilen (oder ganzen Sätzen), weil der offenbar nicht besonders selbstbewusste Komponist sich immer wieder von „wohlmeinenden“ Zeitgenossen verunsichern ließ, sobald diese Kritik an seinen Werken äußerten und er daraufhin bereitwillig „Verbesserungen“ vornahm.
Neben dieser Tatsache muss noch vorangeschickt werden, dass im Konzert lediglich die drei Sätze erklangen, die Bruckner vor seinem Tod bereits fertiggestellt hatte und der in –immerhin recht vollständigen –Skizzen vorliegende Schlusssatz der „Neunten“, von dem es gerade in den letzten Jahren doch einige (umstrittene) Vervollständigungsversuche gegeben hat, nicht gespielt wurde. Auch auf das von Bruckner persönlich als „Notlösung“ für den Fall, dass er seine letzte Sinfonie nicht mehr vollenden könne, vorgesehene Te Deum als Schlusssatz-Ersatz wurde verzichtet.
Zum Glück präsentiert sich dieser gewaltige sinfonische Torso aber auch so für sich stehend als selbständiges Kunstwerk, so dass man auf den Schlusssatz (so interessant er vielleicht noch geworden wäre) auch verzichten kann.
Simone Young hatte das groß besetzte Gürzenich-Orchester gut im Griff, wählte ein nicht zu langsames Grundtempo und bezauberte durch ihre ausdrucksstarke Köpersprache – vor allem im Scherzo (2. Satz), das zwischen den zwei Extremen einer schon weit ins 20. Jahrhundert vorausweisenden gnadenlosen Rhythmusdominanz und eher lyrisch-eleganten Abschnitten hin- und herpendelt, bewies sie dies nachdrücklich. Kein Wunder, dass das Publikum (die Philharmonie war sehr gut besucht und bestand zu einem nicht unerheblichen Teil auch aus Zuhörern um die und unter 30 Jahren!) die Dirigentin nach diesem mitreißenden Einsatz und der hierbei gezeigten Leidenschaft entsprechend bejubelte!
Die Kritik lobte Youngs Herangehensweise an Bruckners Komposition über die Musik und die Stilistik des von ihm geradezu abgöttisch verehrten Richard Wagner, die in Bruckners Werken an vielen Stellen durchscheint - sowohl in der Komposition wie auch der Instrumentation. Ich kenne mich im wagnerschen Klangkosmos nicht wirklich gut aus, das gebe ich gerne zu, aber unter anderem das Ende des 3. Satzes von Bruckners Neunter hatte schon etwas sehr "wagnerisch Weihevolles" an sich und Simone Young tat sicherlich gut daran, diese Anklänge in ihrer Interpretation auch deutlich hörbar zu machen.
Ich muss gestehen, Bruckner ist nicht mein persönlicher Lieblingskomponist und auch die zu Gehör gebrachte 9. Sinfonie bestätigte für mich so manche Eigenart an Bruckners Musik, die mich nicht so begeistert:
Der 3. Satz (das Adagio) hatte mit seinen gut 25 Minuten Spieldauer für mein Empfinden durchaus Längen, die das Ganze unnötig aufblähten. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Satz in einer etwas gestrafften Form noch aussagekräftiger sein könnte.
Oder die Instrumentierung: Bruckner setzt z. B. die gebündelten Blechbläser gern sehr wuchtig, ja geradezu brutal ein (was immerhin live im Konzert durch die schiere Klangwucht, die einen als Zuhörer da überrollt, schon beeindruckt!) und „überfährt“ damit alle anderen Orchestermitglieder gnadenlos – so regelmäßig, wie er das tut, muss man hier wohl von einem bewusst eingesetzten Stilmittel Bruckners sprechen...
Am Dienstag wurde das auch räumlich sehr schön deutlich: Um die Dirigentin herum „ackerten“ sich die zahllosen Streicher durch nicht enden wollende Tremolo-Figuren und über dieses Klangbett fegten dann die leicht erhöht über den Streichern platzierten vereinigten Blechbläser hinweg und übertönten nahezu alles andere!
Ich weiß nicht – mich überzeugte dieses typische (?) "brucknersche Stilmittel" nicht besonders – es klang mir ein bisschen zu tumb und brachial (oder zu „teutonisch“). Da gibt es durchaus Komponisten, die mit einem ähnlich groß besetzten Orchester elegantere Lösungen gefunden haben, die mich persönlich einfach mehr ansprechen.
Aber das ist natürlich Geschmackssache!
Dennoch muss man an dieser Stelle natürlich vor allem den exzellent intonierenden Blechbläsern des Gürzenich-Orchesters ein Kompliment machen – wie eigentlich immer spielte aber das gesamte Ensemble wieder einmal auf höchstem Niveau und es macht Spaß, einem solch kraftvollen Klangkörper als Zuhörer gegenüber zu sitzen und sich von der schon fast physisch zu spürenden „Macht der Töne“ überwältigen zu lassen!
Das Programm des Abends sah wie folgt aus:
Jörg Widmann (geb. 1973)
„Elegie“ für Klarinette und Orchester
Anton Bruckner (1824-96)
Sinfonie Nr. 9 d-moll
Jörg Widmann, Klarinette
Gürzenich-Orchester Köln
Dir.: Simone Young
Man hat nicht so häufig die Gelegenheit, im Rahmen eines „klassischen“ Sinfoniekonzerts ein Stück zu hören, das von seinem Komponisten selber vorgetragen wird. In diesem Zusammenhang ein komischer Gedanke, wenn man sich vorstellt, das so etwas im 18. und 19. Jahrhundert mehr die Regel als die Ausnahme darstellte…
Ich fand es ausgesprochen interessant (und keinesfalls selbstverständlich), dass sich Jörg Widmann im Rahmen der Konzerteinführung im Foyer kurz vor Konzertbeginn noch persönlich zu seiner Komposition äußerte und auch die speziellen technischen Schwierigkeiten und Herausforderungen erklärte, die er dem Klarinettenpart in seiner knapp 20-minütigen Elegie zugedacht hat.
Dieses Stück, eine Auftragskomposition des NDR aus dem Jahr 2006, wollte der sympathische Münchner nicht unbedingt nur als das verstanden wissen, was man beim Werktitel „Elegie“ spontan erwarten würde, nämlich einen getragenen melancholischen Klagegesang. Für Widmann spielen in diesen „Elegie“-Begriff auch noch einige andere Facetten mit hinein, die sich in dem Stück, das aus vielen kleineren, ganz unterschiedliche Stimmungen transportierenden Episoden besteht, dem Zuhörer mitteilen.
Als roten Faden des Werks könnte man die Widmann offenbar sehr faszinierende „höchstmögliche Differenzierung des Einzeltons“ bezeichnen – lange ausgehaltene Töne des Soloinstruments schweben über der Orchesterbegleitung und werden durch Triller, die Erzeugung von Mehrfachklängen aus der Obertonreihe oder chromatischen Bewegungen, die bis in den Vierteltonbereich vorstoßen, stets neu umgefärbt und variiert. Klanglich interessant war auch die Mitwirkung von Harfe, Celesta und Akkordeon im Orchester – gerade die Akkordeonklänge mischten sich teilweise so perfekt mit den Klarinettentönen, dass man gar nicht wusste, welches der beiden Instrumente gerade spielte.
Auch wenn mir persönlich das Stück (zumindest nach nur einmaligem Hören) nicht wirklich zugesagt hat, da es mir im Ganzen doch etwas zu unruhig und episodenhaft war und mir durch die erwähnte Kleinteiligkeit die große Linie fehlte, die ich persönlich für eine „Elegie“ schon erwartet hätte (wobei es natürlich durchaus die Absicht des Komponisten gewesen sein könnte, auch diese Erwartungshaltung zu durchbrechen), so muss ich dem Solisten Jörg Widmann doch großen Respekt zollen:
Er schaffte es, seinem Instrument Töne zu entlocken, die ich bislang noch nie von einer Klarinette zu hören bekommen habe! Da schnarrte und knarzte es ausgiebigst, an manchen Stellen klang die Klarinette fast schon wie das aus ihr hervorgegangene Saxofon und die Tatsache, dass der Solist seinem Instrument mehrere Töne gleichzeitig entlocken konnte, fand ich auch faszinierend! Solche „mitkieksenden“ Obertöne treten – vom Spieler in der Regel nicht kontrollierbar – bei der Klarinette ab und an auf (ich habe das in der Praxis oft genug mitbekommen) und ich stelle es mir sehr schwierig vor, solche „Zufallstöne“ quasi auf Kommando hervorzubringen. Da beherrscht jemand sein Instrument wirklich meisterhaft!
Nach der Pause folgte dann die gut einstündige 9. Bruckner-Sinfonie. Simone Young hatte für ihre Wiedergabe – wie in der Regel bei allen Bruckner-Sinfonien, die sie bislang dirigiert und auch schon auf Tonträger eingespielt hat - die Notentext-Urfassung des Komponisten gewählt. Gerade bei Bruckner-Kompositionen wimmelt es ja oft von Revisionsfassungen, Umstellungen, neu komponierten Teilen (oder ganzen Sätzen), weil der offenbar nicht besonders selbstbewusste Komponist sich immer wieder von „wohlmeinenden“ Zeitgenossen verunsichern ließ, sobald diese Kritik an seinen Werken äußerten und er daraufhin bereitwillig „Verbesserungen“ vornahm.
Neben dieser Tatsache muss noch vorangeschickt werden, dass im Konzert lediglich die drei Sätze erklangen, die Bruckner vor seinem Tod bereits fertiggestellt hatte und der in –immerhin recht vollständigen –Skizzen vorliegende Schlusssatz der „Neunten“, von dem es gerade in den letzten Jahren doch einige (umstrittene) Vervollständigungsversuche gegeben hat, nicht gespielt wurde. Auch auf das von Bruckner persönlich als „Notlösung“ für den Fall, dass er seine letzte Sinfonie nicht mehr vollenden könne, vorgesehene Te Deum als Schlusssatz-Ersatz wurde verzichtet.
Zum Glück präsentiert sich dieser gewaltige sinfonische Torso aber auch so für sich stehend als selbständiges Kunstwerk, so dass man auf den Schlusssatz (so interessant er vielleicht noch geworden wäre) auch verzichten kann.
Simone Young hatte das groß besetzte Gürzenich-Orchester gut im Griff, wählte ein nicht zu langsames Grundtempo und bezauberte durch ihre ausdrucksstarke Köpersprache – vor allem im Scherzo (2. Satz), das zwischen den zwei Extremen einer schon weit ins 20. Jahrhundert vorausweisenden gnadenlosen Rhythmusdominanz und eher lyrisch-eleganten Abschnitten hin- und herpendelt, bewies sie dies nachdrücklich. Kein Wunder, dass das Publikum (die Philharmonie war sehr gut besucht und bestand zu einem nicht unerheblichen Teil auch aus Zuhörern um die und unter 30 Jahren!) die Dirigentin nach diesem mitreißenden Einsatz und der hierbei gezeigten Leidenschaft entsprechend bejubelte!
Die Kritik lobte Youngs Herangehensweise an Bruckners Komposition über die Musik und die Stilistik des von ihm geradezu abgöttisch verehrten Richard Wagner, die in Bruckners Werken an vielen Stellen durchscheint - sowohl in der Komposition wie auch der Instrumentation. Ich kenne mich im wagnerschen Klangkosmos nicht wirklich gut aus, das gebe ich gerne zu, aber unter anderem das Ende des 3. Satzes von Bruckners Neunter hatte schon etwas sehr "wagnerisch Weihevolles" an sich und Simone Young tat sicherlich gut daran, diese Anklänge in ihrer Interpretation auch deutlich hörbar zu machen.
Ich muss gestehen, Bruckner ist nicht mein persönlicher Lieblingskomponist und auch die zu Gehör gebrachte 9. Sinfonie bestätigte für mich so manche Eigenart an Bruckners Musik, die mich nicht so begeistert:
Der 3. Satz (das Adagio) hatte mit seinen gut 25 Minuten Spieldauer für mein Empfinden durchaus Längen, die das Ganze unnötig aufblähten. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Satz in einer etwas gestrafften Form noch aussagekräftiger sein könnte.
Oder die Instrumentierung: Bruckner setzt z. B. die gebündelten Blechbläser gern sehr wuchtig, ja geradezu brutal ein (was immerhin live im Konzert durch die schiere Klangwucht, die einen als Zuhörer da überrollt, schon beeindruckt!) und „überfährt“ damit alle anderen Orchestermitglieder gnadenlos – so regelmäßig, wie er das tut, muss man hier wohl von einem bewusst eingesetzten Stilmittel Bruckners sprechen...
Am Dienstag wurde das auch räumlich sehr schön deutlich: Um die Dirigentin herum „ackerten“ sich die zahllosen Streicher durch nicht enden wollende Tremolo-Figuren und über dieses Klangbett fegten dann die leicht erhöht über den Streichern platzierten vereinigten Blechbläser hinweg und übertönten nahezu alles andere!
Ich weiß nicht – mich überzeugte dieses typische (?) "brucknersche Stilmittel" nicht besonders – es klang mir ein bisschen zu tumb und brachial (oder zu „teutonisch“). Da gibt es durchaus Komponisten, die mit einem ähnlich groß besetzten Orchester elegantere Lösungen gefunden haben, die mich persönlich einfach mehr ansprechen.
Aber das ist natürlich Geschmackssache!
Dennoch muss man an dieser Stelle natürlich vor allem den exzellent intonierenden Blechbläsern des Gürzenich-Orchesters ein Kompliment machen – wie eigentlich immer spielte aber das gesamte Ensemble wieder einmal auf höchstem Niveau und es macht Spaß, einem solch kraftvollen Klangkörper als Zuhörer gegenüber zu sitzen und sich von der schon fast physisch zu spürenden „Macht der Töne“ überwältigen zu lassen!
Donnerstag, 16. Februar 2012
Philharmonie-Konzert: Cameron Carpenter
Auch im Bereich der Klassik gibt es Musiker, die mit ihrer Art deutlich aus dem Rahmen des Üblichen fallen – gerade in der doch eher konservativen Welt altehrwürdiger Konzertsäle und prunkvoller Opernhäuser erregt man mit einem (wie auch immer) unangepassten Auftreten allerdings nach wie vor deutlich mehr Aufmerksamkeit als im Bereich von Jazz- oder Pop-Musik.
Da gibt es neben den kauzig-exzentrischen Vertreten à la Glenn Gould oder den jugendlich-stürmischen Rebellen vom Typ Ivo Pogorelich auch den – allerdings nicht so häufig wie die beiden zuvor erwähnten Prototypen - im Klassik-Zirkus anzutreffenden „Paradiesvogel“, der vor allem durch seine rein äußerliche Aufmachung für einen klassischen Musiker exotisch wirkt.
Der britische Violinist Nigel Kennedy, der vor allem in den 1980er Jahren beim Konzertpublikum mit seinem Punker-Image für Irritation und Faszination gleichermaßen sorgte, war hier sicherlich ein Vorreiter.
Seitdem ist natürlich viel Zeit vergangen und die seitdem nachgewachsenen Generationen junger klassischer Musiker(innen) gehen mittlerweile viel unverkrampfter mit vielen steif und altbacken erscheinenden Riten oder auch Kleidungsvorschriften im Konzertbetrieb um, was ich ganz sympathisch finde.
Um hier noch auffallen zu können, muss man heutzutage dann schon ein paar wirklich unkonventionelle Ideen an den Tag legen – und dem 1981 geborenen US-amerikanischen Organisten Cameron Carpenter ist hier dann doch noch einiges eingefallen, um schon Aufmerksamkeit zu erregen, bevor er überhaupt seiner eigentlichen musikalischen Beschäftigung nachgehen kann:
Seine von einem gewissen athletischen Körperkult ausgehenden figurbetonten Outfits, die er sowohl privat als auch auf der Bühne trägt, sind mittlerweile schon legendär – wenn er die Konzertbühne in seinen in den Farben schwarz und weiß gehaltenen, reichhaltig mit funkelnden Strass-Steinen bestückten Jacken, Hemden, Hosen und Schuhen betritt, dann umweht ihn schon eine für Besucher klassischer Konzerte ziemlich ungewohnte Aura von Glamour, Broadway oder Las Vegas.

Carpenter hat das Glück, dass er außerdem als Organist auch noch eine echte Marktlücke füllen kann – gerade der „Spezies“ der Organisten unterstellt man ja gerne eine gewisse Verschrobenheit, die mit einem nicht gerade publikumswirksamen Auftreten einhergeht. Das mag zwar in den meisten Fällen kompletter Unsinn sein, aber allein die Tatsache, dass man einen Organisten während seines Konzerts meistens nicht zu sehen bekommt, weil er z. B. in der Kirche auf irgendeiner versteckten Orgelempore seine Register ziehen muss und sich allenfalls am Ende kurz und scheu seinem ihm applaudierenden Publikum an der Brüstung der Empore zeigt, sorgt natürlich für die Entstehung solcher Klischees – ich wüsste keine andere Musikergruppe, die sich während der Ausübung ihrer Tätigkeit (in der Regel durch räumliche Gegebenheiten hierzu genötigt) so gut vor ihrem Publikum verbergen kann oder muss, wie eben die der Organisten.
Nun, Cameron Carpenter zählt ganz gewiss nicht zur Gruppe dieser Klischee-Organisten, was wohl auch ein Grund dafür ist, dass er nicht so gerne in Kirchen spielt. Wann immer es ihm möglich ist, bevorzugt er große, moderne (und entsprechend klanggewaltige) Konzertorgeln - die es in modernen Kirchen allerdings auch gibt - deren Spielpulte sich individuell im Raum positionieren lassen und es auch Organisten ermöglichen, ähnlich wie z. B. Pianisten direkt vor ihrem Publikum in die Tasten (und Pedale!) zu greifen. Gerade die Tatsache, dass das Publikum beim Organisten ja viel mehr zu sehen bekommt, als beim „gewöhnlichen“ Pianisten, spricht für Mr Carpenters Präferenz solcher Orgeln – was er und seine Kolleginnen und Kollegen da mit Armen und Beinen, Händen und Füßen für akrobatische, zum Teil schon tänzerisch anmutende Bewegungen ausführen (müssen), um ihre Musik zu spielen, bietet definitiv mehr optische Abwechslung, als es die meisten anderen Instrumentalisten vermögen!
Und während in den letzten Jahren viele junge Gesichter alle möglichen Instrumentengruppen mit frischem Wind erfüllt haben – man denke neben den zahlreichen Pianisten, Violinisten und Cellisten auch an Bratscher, Harfenisten, Trompeter, Blockflötenspieler, Percussionisten und so weiter (alle Bezeichnungen sind natürlich auch in weiblicher Form zu denken!), die auf dem Klassikmarkt in der letzten Zeit für Aufmerksamkeit und Begeisterung gesorgt haben, ist Cameron Carpenter als weithin bekannt gewordener Jung-Organist irgendwie bislang ein ziemlicher Einzelfall geblieben – das meinte ich vorhin mit der Marktlücke, die allein zu füllen er im Moment das große Glück hat.
Dass nicht alle Organisten sein Auftreten (und vor allem seine unkonventionelle, extrem personalisierte Spielweise) goutieren, versteht sich fast von selbst – aber man muss ihm eines lassen: Es hat es immerhin in relativ kurzer Zeit geschafft, der leider oft vernachlässigten und unterschätzten Orgel als Solo- und Konzertinstrument eine bisher nicht für möglich gehaltene Popularität zu verschaffen und das ist ja auch schon etwas!
Symptomatisch ist wahrscheinlich die Tatsache, dass eine Persönlichkeit wie Cameron Carpenter eigentlich nur ein US-Amerikaner sein kann – irgendwie ist es diese von uns in diesem Punkt wohl immer etwas gehemmten Europäern oft etwas beargwöhnte (aber auch insgeheim bewunderte) Fähigkeit, völlig unvoreingenommen und ohne falsche Ehrfurcht an die vermeintlich „hehre“ und unnahbar erscheinende Hochkultur heranzugehen und sich dort das herauszuholen, was für die individuellen Bedürfnisse geeignet erscheint – ohne dabei den steten Grundsatz des aus amerikanischer Sicht wohl über allem stehenden „Entertainment-“ und „Showbusiness-Gedankens“ aus dem Blick zu verlieren.
Und Mr Carpenter beherrscht diese urtypisch amerikanische Mischung aus Unterhaltung und Ernsthaftigkeit auf höchstem Niveau zu 100% - er ist (ganz unabhängig von seinen exzentrisch-glamourösen Outfits) ein charismatischer und sympathischer Künstler, der sein Publikum mitzureißen und zu begeistern versteht, auch wenn er Stücke aus dem absoluten Pflichtrepertoire eines jeden Organisten (nämlich die Kompositionen von Johann Sebastian Bach) spielt, die man von ihm, das gebe ich gerne zu, nicht unbedingt auf Anhieb erwarten würde, wenn man ihn zum ersten Mal sieht.
Am vergangenen Donnerstag (es war der 9. Februar) war Cameron Carpenter nun zum mittlerweile zweiten Mal zu Gast in der Kölner Philharmonie und da ich als Orgel-Fan von ihm natürlich schon gehört und seinen ersten Auftritt in Köln vor etwas über einem Jahr leider versäumt hatte, war ich natürlich ausgesprochen neugierig darauf, diesen Paradiesvogel unter den Organisten einmal live und in Aktion erleben zu können!
Reine Orgelkonzerte finden in der Kölner Philharmonie nicht allzu häufig, aber doch regelmäßig statt (so ca. drei bis vier Mal pro Saison). Ich habe vor ein paar Jahren bereits einmal ein solches Konzert besucht (damals war der Brite Thomas Trotter zu Gast) und musste damals schon feststellen, dass dieses Konzert nicht besonders gut besucht war. Während damals das weite Rund der Kölner Philharmonie nicht einmal zur Hälfte gefüllt war, war der Saal beim letztwöchigen Konzert immerhin zu fast zwei Dritteln gefüllt – für ein reines Orgelkonzert ganz beachtlich, wie ich finde! Es zeigt, welches Publikumspotenzial Mr Carpenter durch seine Künstlerpersönlichkeit zu mobilisieren und zu interessieren in der Lage ist.
Außerdem war das Konzert im Vorfeld entsprechend beworben und in der Presse angekündigt worden. Mit Artikeln, die sich mit einem so ungewöhnlichen Künstler beschäftigen, weckt man natürlich Neugier und Journalisten schreiben sicherlich auch lieber über solche Persönlichkeiten als über unauffällig-brave Musiker, die sich – zumindest vom äußeren Auftreten her – kaum vom Umfeld ihrer zahllosen Kollegen unterscheiden.
Leider ist die Orgel der Kölner Philharmonie nicht wirklich mein Lieblingsinstrument – zum einen ist die Akustik im Saal ziemlich trocken, was meinem Empfinden nach gerade für den Klang einer Orgel ziemlich nachteilig ist. Man kennt Orgelklänge ja hauptsächlich aus mehr oder weniger großen Kirchenräumen, die einen mehr oder weniger starken Hall erzeugen. Sofern dieser Hall nicht zu groß ist, ist er jedoch geradezu ideal als akustischer Begleiter typischer Orgelklänge: Die raumfüllenden, oft lang ausgehaltenen Klänge aus einem sehr großen Tonspektrum bekommen so erst die richtige Mischung aus Wucht, Fülle und majestätischer Größe. Diese ganze Wirkung verpufft leider fast ganz, wenn die Raumakustik diese aus meiner Sicht so wichtige „Zutat“ für Orgelmusik nicht zulässt und den Zuhörer die Töne der Orgel quasi „nackt“ und unverhüllt direkt „anspringen“, ohne nachzuklingen – das hat für mich etwas ernüchterndes, was schwer zu beschreiben ist – aber irgendwie verliert Orgelmusik in so einem „puristischen“ akustischen Umfeld viel von ihrem besonderen Zauber.
Das zweite Problem der Orgel der Kölner Philharmonie ist, dass selbige meines Wissens für diesen Konzertsaal ursprünglich gar nicht vorgesehen war und man sich erst während der eigentlichen Bauphase Mitte der 1980er Jahre dazu entschieden hatte, die Philharmonie auch mit einer großen Konzertorgel auszustatten (den Auftrag erhielt die bekannte Orgelbaufirma Klais aus Bonn). Das führte dann wohl auch dazu, dass sich sämtliche Pfeifen dieses Instruments ausschließlich auf der linken Seite der Bühne der Philharmonie befinden, platztechnisch konnte offenbar kein anderer Platz mehr hierfür zur Verfügung gestellt werden – optimal wäre sicher eine Aufteilung der zahlreichen Pfeifen zu beiden Seiten des Podiums oder eine mittige Anordnung gewesen.
So stellt sich bei Orgelkonzerten vor Ort leider immer ein gewisser „Mono-Effekt“ ein, da sämtliche Töne ausschließlich von links auf das Publikum einströmen. Damit gehen – neben der unvorteilhaften Akustik – weitere mögliche Klangentfaltungsmöglichkeiten verloren, was sehr schade ist!
Immerhin – wenn die Orgel zusammen mit einem Orchester eingesetzt wird (wie ich es z. B. selber bei unserem Chorkonzert mit dem Berlioz-Te Deum erleben konnte), fallen die beschriebenen Nachteile nicht wirklich ins Gewicht und das ist für eine Philharmonie im Zweifel eben ausreichend.
Diese Situation findet nun also jede(r) Organist(in) vor, der/ die in der Kölner Philharmonie auftreten möchte – eine schwierige Aufgabe, die es da zu lösen gilt!
Überhaupt sind Organisten (und das vergisst man leicht) ja gegenüber ihren Kollegen an fast allen anderen Instrumenten hier eindeutig im Nachteil:
Während diese in der Regel ihre eigenen Instrumente haben, mit denen sie seit Jahren bestens vertraut sind und die sie selbstverständlich auf ihre Konzerttourneen mitnehmen, müssen sich Organisten jeweils vor Ort immer auf ganz unterschiedliche Instrumente einstellen und im Gegensatz z. B. zu einem Steinway-Flügel, der in New York normalerweise ähnlich klingt und reagiert wie in Berlin, gleicht wohl keine Orgel der anderen, da es sich hierbei immer um individuelle Anfertigungen handelt, die jeweils auf die ganz speziellen Wünsche und Gegebenheiten von Auftraggebern und Räumlichkeiten abgestimmt wurden.
Um ein professionelles Konzert abliefern zu können, benötigt ein Organist mit Sicherheit ein paar Stunden, in denen er sich intensiv mit dem Instrument beschäftigt.
Auch Mr Carpenter hat sich im Vorfeld mit der Orgel der Kölner Philharmonie befasst (immerhin kannte er das Instrument ja schon aus dem Vorjahr) und in diesem Zusammenhang am Tag des Konzerts auch die halbstündige öffentliche Probe zur Mittagszeit (unter dem Titel „PhilharmonieLunch“) bestritten.
Ich habe gelesen, dass Cameron Carpenter plant, in nicht allzu ferner Zukunft mit einer eigenen, digitalen Orgel (die also keine Pfeifen zur Tonerzeugung benötigt sondern lediglich eine gute Lautsprecheranlage), die ganz nach seinen persönlichen Wünschen und Erfordernissen gebaut wurde, auf Tournee zu gehen, was natürlich für ihn einen enormen Vorteil bringen würde (vom logistischen Problem des Transports dieses sicher nicht gerade kleinen Instruments einmal abgesehen.) Allerdings hängt diese Idee derzeit wohl noch von der Finanzierung ab – einen Betrag in Höhe von ca. 750.000 USD muss man erstmal zusammenbekommen…
Am Abend des Konzerts war ich sehr erstaunt, dass sich der Künstler noch kurz vor Konzertbeginn freundlich lächelnd und sichtlich entspannt im Zuschauerraum aufhielt, in den vorderen Reihen Zuhörer begrüßte, Hände schüttelte und Autogramme gab – so etwas habe ich auch noch nicht erlebt; es passt aber in das oben gezeichnete Bild vom sympathisch-unkonventionellen Amerikaner.
Zu Beginn seines Konzerts (es gab kein „offizielles“ Programm, die einzelnen Stücke wurden vom Solisten nach kurzer vorheriger Ansage gespielt) bewies Mr Carpenter seine erstaunliche „Fußfertigkeit“, in dem er ein Stück vortrug, das er lediglich auf den Pedalen der Orgel spielte. Berühmt geworden ist ja das Video, auf dem man erleben kann, wie er die bekannte „Revolutionsetüde“ von Chopin, die ja eigentlich fürs Klavier komponiert wurde, ebenfalls nur auf den Pedalen einer Orgel zum Besten gibt. Vergangene Woche spielte er ein Prélude aus einer der Cello-Suiten von Johann Sebastian Bach – das Ganze hatte schon etwas durchaus Akrobatisches, das muss ich sagen!
Danach ging es gleich weiter mit Bach, dem „Hausgott“ wohl aller Organisten, von dem Carpenter nun zunächst die Fantasie und Fuge g-moll (BWV 542) und gleich im Anschluss das Präludium und Fuge G-Dur (BWV 541) spielte.
Während er den dramatischen Beginn der g-moll-Fantasie mit vollem Werk und großer Geste auskostete, nahm er sich ansonsten über weite Strecken sehr zurück und ließ auch die leisen und zarten Stimmen der Orgel zu ihrem Recht kommen, was den vorgetragenen Stücken gut tat. Carpenter ist sicher nicht der Typ, der sich mit Begeisterung an eine historische Barockorgel setzen würde – er braucht die Vielzahl von Manualen und Registern einer modernen Konzertorgel, es spricht aber für ihn, dass er diese schon sehr gezielt einsetzt und nicht der Versuchung erliegt, permanent sämtliches ihm zur Verfügung stehendes „akustisches Pulver“ zu verschießen.
Von einer seiner CDs kenne ich seine Interpretation der berühmten Toccata und Fuge d-moll (BWV 565) und da wird wirklich dick aufgetragen in puncto Dramatik und Klangwucht!
Aber wie gesagt – im Kölner Konzert ging gerade der Bach eher im schlanken Klanggewand über die Bühne, dafür aber in einem generell schon als „sportlich“ zu bezeichnenden Grundtempo, was gerade die Fugen ausgesprochen frisch und lebendig rüberkommen ließ. Carpenters hierfür benötigte Virtuosität ist wirklich beeindruckend!
Etwas gewöhnungsbedürftig fand ich die Tatsache, dass unser Organist wie in einem Solokonzert kurz vor dem Ende der G-Dur-Fuge eine improvisierte (?) Kadenz einfügte, in der sich plötzlich jazzige Klänge mit immer neuen virtuosen Tonkaskaden mischten, was an sich ganz annehmbar klang, für mich inmitten dieser Bach-Fuge jedoch eindeutig deplatziert wirkte! Mr Carpenter scheint an dieser Stelle offenbar regelmäßig „stilbrüchig“ zu werden – auf seiner CD „Cameron Carpenter – LIVE!“ ist der Mitschnitt eines Konzerts enthalten, in dem er ebenfalls das Präludium und Fuge G-Dur (BWV 541) zum Besten gibt und sich an selber Stelle einer ausufernden Kadenz hingibt, die mir allerdings noch unpassender zu sein scheint, als das, was er sich letzte Woche im Konzert ausgedacht hatte…

Im Kölner Programm folgte nach dieser geballten „Bach-Ladung“ eine Suite, bestehend aus drei eigenhändigen Arrangements von Liedern (für die Gattung des Kunstlieds interessiere er sich in der letzten Zeit ganz besonders, wie Carpenter erläuterte), die mir allerdings etwas zusammenhanglos erschien: Ein Titel aus Robert Schumanns Liederzyklus „Frauenliebe und –leben“, gefolgt von „One of these days“ der Band The Velvet Underground und schließlich der „Erlkönig“ in der berühmten Vertonung von Franz Schubert.
Als er mit dem Erlkönig begonnen hatte (verschiedene Registrierungen für die unterschiedlichen Personen der Ballade nutzend, wobei er auch mit Vorliebe die ganz tiefen Töne schnarren und „rumpeln“ ließ), brach er seinen Vortrag überraschend nach kurzer Zeit ab und entschuldigte sich hierfür, da es offenbar einen Defekt an der Orgel gegeben habe, der mir als Zuhörer gar nicht aufgefallen war. Er setzte erneut an und spielte mit erstaunlicher Gelassenheit dieses Stück nun komplett durch (wobei man ihm schon anmerkte, dass er sich über diesen Vorfall gewaltig ärgerte) und gab danach bekannt, dass die Pause nun vorgezogen werde, da die Orgel zunächst repariert werden müsse, bevor es weitergehen könne.
Zum Glück waren die hierfür erforderlichen beiden Techniker direkt anwesend (vielleicht extra aus dem Hause Klais angereist?) und machten sich sofort über den Spieltisch her – ich habe keine Ahnung, was an der Orgel nun eigentlich kaputt gegangen war (ein Pedal?), zum Glück ließ es sich schnell wieder reparieren, so dass das Konzert nach einer 20-minütigen Pause weitergehen konnte. Durch seinen souveränen und professionellen Umgang mit dieser unvorhergesehenen Panne konnte Cameron Carpenter nun erst recht die Herzen des Kölner Publikums für sich gewinnen.
Nach der Pause ging es mit dem Stück weiter, das eigentlich den ersten Konzertteil beschließen sollte, nämlich das Präludium und Fuge h-moll (BWV 544) – dieses kannte ich bislang vor allem in eher feierlich-wuchtigen Interpretationen, während Carpenter das ganze Stück erneut in betonter Zurückhaltung, fast schon leichtfüßig (und in der nun schon gewohnten erhöhten Geschwindigkeit) interpretierte. Auch eine durchaus überzeugende Interpretationsmöglichkeit, wie man feststellen konnte – Bachs Musik lässt ja viele Lesarten zu und verfehlt ihre Wirkung eigentlich nie.
Den zweiten Teil des Konzerts nahm nun die gewaltige Fantasie und Fuge über den Choral „Ad nos, ad salutarem undam“ von Franz Liszt ein – eine echte Herausforderung für jeden Interpreten, Liszt verlangt seinen Solisten ja häufig körperliche Höchstleistungen ab, die überhaupt erst Voraussetzung für eine interpretatorische Gestaltung sind!
Auch für dieses Mammutwerk (er bezeichnete es als eine Art „Oper für die Orgel“) wählte Carpenter ein zügiges Tempo, was dazu führte, dass er für das Stück statt der eigentlich üblichen knappen halben Stunde nicht einmal 25 Minuten brauchte!
Allerdings sorgte die Orgel dafür, dass gerade die lauten Stellen, in denen Liszt der Orgel wirklich alles abverlangt, doch etwas lärmend wirkten – die Akustik im Saal ist einfach für solche großdimensionierten Orgelwerke nicht wirklich geeignet…
Weitaus besser klang da definitiv die Orgel in der Düsseldorfer Johanneskirche (eben gerade auch in Verbindung mit der Akustik des Kirchenraums), als ich im Rahmen der Lunch-Time-Orgel Liszts „Ad nos“ im vergangenen November zuletzt gehört hatte!
Mr Carpenter gab im letztwöchigen Konzert jedenfalls wirklich alles und holte das aus der Orgel in der Kölner Philharmonie raus, was machbar war – entsprechend wurde er mit frenetischem Applaus belohnt.
Er spielte dann noch drei (!) längere Zugaben: Ein Stück im Stil einer Toccata à la Widor; dann ein hochvirtuoses Stück, das stellenweise an den berühmten „Hummelflug“ oder an mit den Flügeln flatternde Vögel erinnerte und zu guter Letzt einen kleinen Zyklus von Variationen über eine volksliedartige Melodie.
Mr Carpenter mag ein etwas unorthodox auftretender Künstler sein (und damit viele Kritiker auf den Plan rufen), aber er versteht es, sein Publikum auf höchstem technischen Niveau zu begeistern und beweist bravourös, dass auch die gute alte Orgel einen hohen Unterhaltungswert besitzt! Dass gerade seine Bach-Interpretationen nicht unbedingt stilistisch korrekte Wiedergaben barocker Orgelmusik sind, verzeiht man ihm da gerne – diese kann man sich dann ja immer noch bei einer anderen Gelegenheit anhören. Denn eine in jeder Hinsicht erfrischende Abwechslung bietet Mr Carpenter in jedem Fall!
Da gibt es neben den kauzig-exzentrischen Vertreten à la Glenn Gould oder den jugendlich-stürmischen Rebellen vom Typ Ivo Pogorelich auch den – allerdings nicht so häufig wie die beiden zuvor erwähnten Prototypen - im Klassik-Zirkus anzutreffenden „Paradiesvogel“, der vor allem durch seine rein äußerliche Aufmachung für einen klassischen Musiker exotisch wirkt.
Der britische Violinist Nigel Kennedy, der vor allem in den 1980er Jahren beim Konzertpublikum mit seinem Punker-Image für Irritation und Faszination gleichermaßen sorgte, war hier sicherlich ein Vorreiter.
Seitdem ist natürlich viel Zeit vergangen und die seitdem nachgewachsenen Generationen junger klassischer Musiker(innen) gehen mittlerweile viel unverkrampfter mit vielen steif und altbacken erscheinenden Riten oder auch Kleidungsvorschriften im Konzertbetrieb um, was ich ganz sympathisch finde.
Um hier noch auffallen zu können, muss man heutzutage dann schon ein paar wirklich unkonventionelle Ideen an den Tag legen – und dem 1981 geborenen US-amerikanischen Organisten Cameron Carpenter ist hier dann doch noch einiges eingefallen, um schon Aufmerksamkeit zu erregen, bevor er überhaupt seiner eigentlichen musikalischen Beschäftigung nachgehen kann:
Seine von einem gewissen athletischen Körperkult ausgehenden figurbetonten Outfits, die er sowohl privat als auch auf der Bühne trägt, sind mittlerweile schon legendär – wenn er die Konzertbühne in seinen in den Farben schwarz und weiß gehaltenen, reichhaltig mit funkelnden Strass-Steinen bestückten Jacken, Hemden, Hosen und Schuhen betritt, dann umweht ihn schon eine für Besucher klassischer Konzerte ziemlich ungewohnte Aura von Glamour, Broadway oder Las Vegas.

Carpenter hat das Glück, dass er außerdem als Organist auch noch eine echte Marktlücke füllen kann – gerade der „Spezies“ der Organisten unterstellt man ja gerne eine gewisse Verschrobenheit, die mit einem nicht gerade publikumswirksamen Auftreten einhergeht. Das mag zwar in den meisten Fällen kompletter Unsinn sein, aber allein die Tatsache, dass man einen Organisten während seines Konzerts meistens nicht zu sehen bekommt, weil er z. B. in der Kirche auf irgendeiner versteckten Orgelempore seine Register ziehen muss und sich allenfalls am Ende kurz und scheu seinem ihm applaudierenden Publikum an der Brüstung der Empore zeigt, sorgt natürlich für die Entstehung solcher Klischees – ich wüsste keine andere Musikergruppe, die sich während der Ausübung ihrer Tätigkeit (in der Regel durch räumliche Gegebenheiten hierzu genötigt) so gut vor ihrem Publikum verbergen kann oder muss, wie eben die der Organisten.
Nun, Cameron Carpenter zählt ganz gewiss nicht zur Gruppe dieser Klischee-Organisten, was wohl auch ein Grund dafür ist, dass er nicht so gerne in Kirchen spielt. Wann immer es ihm möglich ist, bevorzugt er große, moderne (und entsprechend klanggewaltige) Konzertorgeln - die es in modernen Kirchen allerdings auch gibt - deren Spielpulte sich individuell im Raum positionieren lassen und es auch Organisten ermöglichen, ähnlich wie z. B. Pianisten direkt vor ihrem Publikum in die Tasten (und Pedale!) zu greifen. Gerade die Tatsache, dass das Publikum beim Organisten ja viel mehr zu sehen bekommt, als beim „gewöhnlichen“ Pianisten, spricht für Mr Carpenters Präferenz solcher Orgeln – was er und seine Kolleginnen und Kollegen da mit Armen und Beinen, Händen und Füßen für akrobatische, zum Teil schon tänzerisch anmutende Bewegungen ausführen (müssen), um ihre Musik zu spielen, bietet definitiv mehr optische Abwechslung, als es die meisten anderen Instrumentalisten vermögen!
Und während in den letzten Jahren viele junge Gesichter alle möglichen Instrumentengruppen mit frischem Wind erfüllt haben – man denke neben den zahlreichen Pianisten, Violinisten und Cellisten auch an Bratscher, Harfenisten, Trompeter, Blockflötenspieler, Percussionisten und so weiter (alle Bezeichnungen sind natürlich auch in weiblicher Form zu denken!), die auf dem Klassikmarkt in der letzten Zeit für Aufmerksamkeit und Begeisterung gesorgt haben, ist Cameron Carpenter als weithin bekannt gewordener Jung-Organist irgendwie bislang ein ziemlicher Einzelfall geblieben – das meinte ich vorhin mit der Marktlücke, die allein zu füllen er im Moment das große Glück hat.
Dass nicht alle Organisten sein Auftreten (und vor allem seine unkonventionelle, extrem personalisierte Spielweise) goutieren, versteht sich fast von selbst – aber man muss ihm eines lassen: Es hat es immerhin in relativ kurzer Zeit geschafft, der leider oft vernachlässigten und unterschätzten Orgel als Solo- und Konzertinstrument eine bisher nicht für möglich gehaltene Popularität zu verschaffen und das ist ja auch schon etwas!
Symptomatisch ist wahrscheinlich die Tatsache, dass eine Persönlichkeit wie Cameron Carpenter eigentlich nur ein US-Amerikaner sein kann – irgendwie ist es diese von uns in diesem Punkt wohl immer etwas gehemmten Europäern oft etwas beargwöhnte (aber auch insgeheim bewunderte) Fähigkeit, völlig unvoreingenommen und ohne falsche Ehrfurcht an die vermeintlich „hehre“ und unnahbar erscheinende Hochkultur heranzugehen und sich dort das herauszuholen, was für die individuellen Bedürfnisse geeignet erscheint – ohne dabei den steten Grundsatz des aus amerikanischer Sicht wohl über allem stehenden „Entertainment-“ und „Showbusiness-Gedankens“ aus dem Blick zu verlieren.
Und Mr Carpenter beherrscht diese urtypisch amerikanische Mischung aus Unterhaltung und Ernsthaftigkeit auf höchstem Niveau zu 100% - er ist (ganz unabhängig von seinen exzentrisch-glamourösen Outfits) ein charismatischer und sympathischer Künstler, der sein Publikum mitzureißen und zu begeistern versteht, auch wenn er Stücke aus dem absoluten Pflichtrepertoire eines jeden Organisten (nämlich die Kompositionen von Johann Sebastian Bach) spielt, die man von ihm, das gebe ich gerne zu, nicht unbedingt auf Anhieb erwarten würde, wenn man ihn zum ersten Mal sieht.
Am vergangenen Donnerstag (es war der 9. Februar) war Cameron Carpenter nun zum mittlerweile zweiten Mal zu Gast in der Kölner Philharmonie und da ich als Orgel-Fan von ihm natürlich schon gehört und seinen ersten Auftritt in Köln vor etwas über einem Jahr leider versäumt hatte, war ich natürlich ausgesprochen neugierig darauf, diesen Paradiesvogel unter den Organisten einmal live und in Aktion erleben zu können!
Reine Orgelkonzerte finden in der Kölner Philharmonie nicht allzu häufig, aber doch regelmäßig statt (so ca. drei bis vier Mal pro Saison). Ich habe vor ein paar Jahren bereits einmal ein solches Konzert besucht (damals war der Brite Thomas Trotter zu Gast) und musste damals schon feststellen, dass dieses Konzert nicht besonders gut besucht war. Während damals das weite Rund der Kölner Philharmonie nicht einmal zur Hälfte gefüllt war, war der Saal beim letztwöchigen Konzert immerhin zu fast zwei Dritteln gefüllt – für ein reines Orgelkonzert ganz beachtlich, wie ich finde! Es zeigt, welches Publikumspotenzial Mr Carpenter durch seine Künstlerpersönlichkeit zu mobilisieren und zu interessieren in der Lage ist.
Außerdem war das Konzert im Vorfeld entsprechend beworben und in der Presse angekündigt worden. Mit Artikeln, die sich mit einem so ungewöhnlichen Künstler beschäftigen, weckt man natürlich Neugier und Journalisten schreiben sicherlich auch lieber über solche Persönlichkeiten als über unauffällig-brave Musiker, die sich – zumindest vom äußeren Auftreten her – kaum vom Umfeld ihrer zahllosen Kollegen unterscheiden.
Leider ist die Orgel der Kölner Philharmonie nicht wirklich mein Lieblingsinstrument – zum einen ist die Akustik im Saal ziemlich trocken, was meinem Empfinden nach gerade für den Klang einer Orgel ziemlich nachteilig ist. Man kennt Orgelklänge ja hauptsächlich aus mehr oder weniger großen Kirchenräumen, die einen mehr oder weniger starken Hall erzeugen. Sofern dieser Hall nicht zu groß ist, ist er jedoch geradezu ideal als akustischer Begleiter typischer Orgelklänge: Die raumfüllenden, oft lang ausgehaltenen Klänge aus einem sehr großen Tonspektrum bekommen so erst die richtige Mischung aus Wucht, Fülle und majestätischer Größe. Diese ganze Wirkung verpufft leider fast ganz, wenn die Raumakustik diese aus meiner Sicht so wichtige „Zutat“ für Orgelmusik nicht zulässt und den Zuhörer die Töne der Orgel quasi „nackt“ und unverhüllt direkt „anspringen“, ohne nachzuklingen – das hat für mich etwas ernüchterndes, was schwer zu beschreiben ist – aber irgendwie verliert Orgelmusik in so einem „puristischen“ akustischen Umfeld viel von ihrem besonderen Zauber.
Das zweite Problem der Orgel der Kölner Philharmonie ist, dass selbige meines Wissens für diesen Konzertsaal ursprünglich gar nicht vorgesehen war und man sich erst während der eigentlichen Bauphase Mitte der 1980er Jahre dazu entschieden hatte, die Philharmonie auch mit einer großen Konzertorgel auszustatten (den Auftrag erhielt die bekannte Orgelbaufirma Klais aus Bonn). Das führte dann wohl auch dazu, dass sich sämtliche Pfeifen dieses Instruments ausschließlich auf der linken Seite der Bühne der Philharmonie befinden, platztechnisch konnte offenbar kein anderer Platz mehr hierfür zur Verfügung gestellt werden – optimal wäre sicher eine Aufteilung der zahlreichen Pfeifen zu beiden Seiten des Podiums oder eine mittige Anordnung gewesen.
So stellt sich bei Orgelkonzerten vor Ort leider immer ein gewisser „Mono-Effekt“ ein, da sämtliche Töne ausschließlich von links auf das Publikum einströmen. Damit gehen – neben der unvorteilhaften Akustik – weitere mögliche Klangentfaltungsmöglichkeiten verloren, was sehr schade ist!
Immerhin – wenn die Orgel zusammen mit einem Orchester eingesetzt wird (wie ich es z. B. selber bei unserem Chorkonzert mit dem Berlioz-Te Deum erleben konnte), fallen die beschriebenen Nachteile nicht wirklich ins Gewicht und das ist für eine Philharmonie im Zweifel eben ausreichend.
Diese Situation findet nun also jede(r) Organist(in) vor, der/ die in der Kölner Philharmonie auftreten möchte – eine schwierige Aufgabe, die es da zu lösen gilt!
Überhaupt sind Organisten (und das vergisst man leicht) ja gegenüber ihren Kollegen an fast allen anderen Instrumenten hier eindeutig im Nachteil:
Während diese in der Regel ihre eigenen Instrumente haben, mit denen sie seit Jahren bestens vertraut sind und die sie selbstverständlich auf ihre Konzerttourneen mitnehmen, müssen sich Organisten jeweils vor Ort immer auf ganz unterschiedliche Instrumente einstellen und im Gegensatz z. B. zu einem Steinway-Flügel, der in New York normalerweise ähnlich klingt und reagiert wie in Berlin, gleicht wohl keine Orgel der anderen, da es sich hierbei immer um individuelle Anfertigungen handelt, die jeweils auf die ganz speziellen Wünsche und Gegebenheiten von Auftraggebern und Räumlichkeiten abgestimmt wurden.
Um ein professionelles Konzert abliefern zu können, benötigt ein Organist mit Sicherheit ein paar Stunden, in denen er sich intensiv mit dem Instrument beschäftigt.
Auch Mr Carpenter hat sich im Vorfeld mit der Orgel der Kölner Philharmonie befasst (immerhin kannte er das Instrument ja schon aus dem Vorjahr) und in diesem Zusammenhang am Tag des Konzerts auch die halbstündige öffentliche Probe zur Mittagszeit (unter dem Titel „PhilharmonieLunch“) bestritten.
Ich habe gelesen, dass Cameron Carpenter plant, in nicht allzu ferner Zukunft mit einer eigenen, digitalen Orgel (die also keine Pfeifen zur Tonerzeugung benötigt sondern lediglich eine gute Lautsprecheranlage), die ganz nach seinen persönlichen Wünschen und Erfordernissen gebaut wurde, auf Tournee zu gehen, was natürlich für ihn einen enormen Vorteil bringen würde (vom logistischen Problem des Transports dieses sicher nicht gerade kleinen Instruments einmal abgesehen.) Allerdings hängt diese Idee derzeit wohl noch von der Finanzierung ab – einen Betrag in Höhe von ca. 750.000 USD muss man erstmal zusammenbekommen…
Am Abend des Konzerts war ich sehr erstaunt, dass sich der Künstler noch kurz vor Konzertbeginn freundlich lächelnd und sichtlich entspannt im Zuschauerraum aufhielt, in den vorderen Reihen Zuhörer begrüßte, Hände schüttelte und Autogramme gab – so etwas habe ich auch noch nicht erlebt; es passt aber in das oben gezeichnete Bild vom sympathisch-unkonventionellen Amerikaner.
Zu Beginn seines Konzerts (es gab kein „offizielles“ Programm, die einzelnen Stücke wurden vom Solisten nach kurzer vorheriger Ansage gespielt) bewies Mr Carpenter seine erstaunliche „Fußfertigkeit“, in dem er ein Stück vortrug, das er lediglich auf den Pedalen der Orgel spielte. Berühmt geworden ist ja das Video, auf dem man erleben kann, wie er die bekannte „Revolutionsetüde“ von Chopin, die ja eigentlich fürs Klavier komponiert wurde, ebenfalls nur auf den Pedalen einer Orgel zum Besten gibt. Vergangene Woche spielte er ein Prélude aus einer der Cello-Suiten von Johann Sebastian Bach – das Ganze hatte schon etwas durchaus Akrobatisches, das muss ich sagen!
Danach ging es gleich weiter mit Bach, dem „Hausgott“ wohl aller Organisten, von dem Carpenter nun zunächst die Fantasie und Fuge g-moll (BWV 542) und gleich im Anschluss das Präludium und Fuge G-Dur (BWV 541) spielte.
Während er den dramatischen Beginn der g-moll-Fantasie mit vollem Werk und großer Geste auskostete, nahm er sich ansonsten über weite Strecken sehr zurück und ließ auch die leisen und zarten Stimmen der Orgel zu ihrem Recht kommen, was den vorgetragenen Stücken gut tat. Carpenter ist sicher nicht der Typ, der sich mit Begeisterung an eine historische Barockorgel setzen würde – er braucht die Vielzahl von Manualen und Registern einer modernen Konzertorgel, es spricht aber für ihn, dass er diese schon sehr gezielt einsetzt und nicht der Versuchung erliegt, permanent sämtliches ihm zur Verfügung stehendes „akustisches Pulver“ zu verschießen.
Von einer seiner CDs kenne ich seine Interpretation der berühmten Toccata und Fuge d-moll (BWV 565) und da wird wirklich dick aufgetragen in puncto Dramatik und Klangwucht!
Aber wie gesagt – im Kölner Konzert ging gerade der Bach eher im schlanken Klanggewand über die Bühne, dafür aber in einem generell schon als „sportlich“ zu bezeichnenden Grundtempo, was gerade die Fugen ausgesprochen frisch und lebendig rüberkommen ließ. Carpenters hierfür benötigte Virtuosität ist wirklich beeindruckend!
Etwas gewöhnungsbedürftig fand ich die Tatsache, dass unser Organist wie in einem Solokonzert kurz vor dem Ende der G-Dur-Fuge eine improvisierte (?) Kadenz einfügte, in der sich plötzlich jazzige Klänge mit immer neuen virtuosen Tonkaskaden mischten, was an sich ganz annehmbar klang, für mich inmitten dieser Bach-Fuge jedoch eindeutig deplatziert wirkte! Mr Carpenter scheint an dieser Stelle offenbar regelmäßig „stilbrüchig“ zu werden – auf seiner CD „Cameron Carpenter – LIVE!“ ist der Mitschnitt eines Konzerts enthalten, in dem er ebenfalls das Präludium und Fuge G-Dur (BWV 541) zum Besten gibt und sich an selber Stelle einer ausufernden Kadenz hingibt, die mir allerdings noch unpassender zu sein scheint, als das, was er sich letzte Woche im Konzert ausgedacht hatte…

Im Kölner Programm folgte nach dieser geballten „Bach-Ladung“ eine Suite, bestehend aus drei eigenhändigen Arrangements von Liedern (für die Gattung des Kunstlieds interessiere er sich in der letzten Zeit ganz besonders, wie Carpenter erläuterte), die mir allerdings etwas zusammenhanglos erschien: Ein Titel aus Robert Schumanns Liederzyklus „Frauenliebe und –leben“, gefolgt von „One of these days“ der Band The Velvet Underground und schließlich der „Erlkönig“ in der berühmten Vertonung von Franz Schubert.
Als er mit dem Erlkönig begonnen hatte (verschiedene Registrierungen für die unterschiedlichen Personen der Ballade nutzend, wobei er auch mit Vorliebe die ganz tiefen Töne schnarren und „rumpeln“ ließ), brach er seinen Vortrag überraschend nach kurzer Zeit ab und entschuldigte sich hierfür, da es offenbar einen Defekt an der Orgel gegeben habe, der mir als Zuhörer gar nicht aufgefallen war. Er setzte erneut an und spielte mit erstaunlicher Gelassenheit dieses Stück nun komplett durch (wobei man ihm schon anmerkte, dass er sich über diesen Vorfall gewaltig ärgerte) und gab danach bekannt, dass die Pause nun vorgezogen werde, da die Orgel zunächst repariert werden müsse, bevor es weitergehen könne.
Zum Glück waren die hierfür erforderlichen beiden Techniker direkt anwesend (vielleicht extra aus dem Hause Klais angereist?) und machten sich sofort über den Spieltisch her – ich habe keine Ahnung, was an der Orgel nun eigentlich kaputt gegangen war (ein Pedal?), zum Glück ließ es sich schnell wieder reparieren, so dass das Konzert nach einer 20-minütigen Pause weitergehen konnte. Durch seinen souveränen und professionellen Umgang mit dieser unvorhergesehenen Panne konnte Cameron Carpenter nun erst recht die Herzen des Kölner Publikums für sich gewinnen.
Nach der Pause ging es mit dem Stück weiter, das eigentlich den ersten Konzertteil beschließen sollte, nämlich das Präludium und Fuge h-moll (BWV 544) – dieses kannte ich bislang vor allem in eher feierlich-wuchtigen Interpretationen, während Carpenter das ganze Stück erneut in betonter Zurückhaltung, fast schon leichtfüßig (und in der nun schon gewohnten erhöhten Geschwindigkeit) interpretierte. Auch eine durchaus überzeugende Interpretationsmöglichkeit, wie man feststellen konnte – Bachs Musik lässt ja viele Lesarten zu und verfehlt ihre Wirkung eigentlich nie.
Den zweiten Teil des Konzerts nahm nun die gewaltige Fantasie und Fuge über den Choral „Ad nos, ad salutarem undam“ von Franz Liszt ein – eine echte Herausforderung für jeden Interpreten, Liszt verlangt seinen Solisten ja häufig körperliche Höchstleistungen ab, die überhaupt erst Voraussetzung für eine interpretatorische Gestaltung sind!
Auch für dieses Mammutwerk (er bezeichnete es als eine Art „Oper für die Orgel“) wählte Carpenter ein zügiges Tempo, was dazu führte, dass er für das Stück statt der eigentlich üblichen knappen halben Stunde nicht einmal 25 Minuten brauchte!
Allerdings sorgte die Orgel dafür, dass gerade die lauten Stellen, in denen Liszt der Orgel wirklich alles abverlangt, doch etwas lärmend wirkten – die Akustik im Saal ist einfach für solche großdimensionierten Orgelwerke nicht wirklich geeignet…
Weitaus besser klang da definitiv die Orgel in der Düsseldorfer Johanneskirche (eben gerade auch in Verbindung mit der Akustik des Kirchenraums), als ich im Rahmen der Lunch-Time-Orgel Liszts „Ad nos“ im vergangenen November zuletzt gehört hatte!
Mr Carpenter gab im letztwöchigen Konzert jedenfalls wirklich alles und holte das aus der Orgel in der Kölner Philharmonie raus, was machbar war – entsprechend wurde er mit frenetischem Applaus belohnt.
Er spielte dann noch drei (!) längere Zugaben: Ein Stück im Stil einer Toccata à la Widor; dann ein hochvirtuoses Stück, das stellenweise an den berühmten „Hummelflug“ oder an mit den Flügeln flatternde Vögel erinnerte und zu guter Letzt einen kleinen Zyklus von Variationen über eine volksliedartige Melodie.
Mr Carpenter mag ein etwas unorthodox auftretender Künstler sein (und damit viele Kritiker auf den Plan rufen), aber er versteht es, sein Publikum auf höchstem technischen Niveau zu begeistern und beweist bravourös, dass auch die gute alte Orgel einen hohen Unterhaltungswert besitzt! Dass gerade seine Bach-Interpretationen nicht unbedingt stilistisch korrekte Wiedergaben barocker Orgelmusik sind, verzeiht man ihm da gerne – diese kann man sich dann ja immer noch bei einer anderen Gelegenheit anhören. Denn eine in jeder Hinsicht erfrischende Abwechslung bietet Mr Carpenter in jedem Fall!
Donnerstag, 2. Februar 2012
Philharmonie-Konzert
Vorgestern, also am 31. Januar, hatte ich wieder einmal Gelegenheit, mir eines der Konzerte des Gürzenich-Orchesters in der Kölner Philharmonie anzuhören.
Der Programmzettel des Abends sah wie folgt aus:
Carl Nielsen (1865-1931)
„Helios“ Ouvertüre für Orchester op. 17
W. A. Mozart (1756-91)
Konzert für Violine und Orchester Nr. 4 D-Dur KV 218
Richard Strauss (1864-1949)
„Sinfonia domestica“ für großes Orchester F-Dur op. 53
Patricia Kopatchinskaja, Violine
Gürzenich-Orchester Köln
Dirigent: Ulf Schirmer
Wie eigentlich alle Konzerte des Gürzenich-Orchesters, die ich in der letzten Zeit besucht habe (siehe meine entsprechenden Konzertberichte in diesem Blog), war auch dieses wieder erfreulich gut besucht: In der zu gut 80% ausgelasteten Kölner Philharmonie sah man auch eine ganze Reihe junger Konzertbesucher – sowas freut mich natürlich immer ganz besonders!
Abgesehen davon, dass ich das Programm des Abends ein bisschen wahllos zusammengestellt fand (immerhin sind die Kompositionen von Nielsen und Strauss im selben Jahr 1903 entstanden), gab es an der Leistung des gut aufgelegten Gürzenich-Orchesters nichts auszusetzen.
Vor allem die Strauss-Symphonie, die den 2. Teil des Konzertabends füllte, ließ keine Wünsche offen: Es macht einfach Spaß, ein üppig besetztes, mehr als 100-köpfiges Orchester beim Musizieren beobachten zu können und in den Live-Genuss der sich hieraus ergebenden üppigen Klänge zu kommen! Strauss‘ Tondichtung ist ein sehr dankbares Orchesterstück (in dem Strauss sein Familien- und Eheleben teils augenzwinkernd, teils mit großer Gefühlsgeste in Musik umsetzt), das wirklich alle Stimmgruppen des spätromantischen Orchesterapparats zur Geltung kommen lässt und bei dem ein Spitzenorchester zeigen kann, was alles in ihm steckt!
Ähnlich groß besetzt (aber nicht ganz so üppig wie bei Strauss) war das Gürzenich-Orchester bei der einleitenden Konzertouvertüre „Helios“ des dänischen Komponisten Carl Nielsen. Nielsen dürfte neben Niels Wilhelm Gade (1817-90) wohl der auch im Ausland bekannteste Komponist Dänemarks sein – nützlich für den Fall, dass man mal nach einem dänischen Komponisten gefragt wird und einem nur Namen wie Edvard Grieg (Norwegen) oder Jean Sibelius (Finnland) einfallen sollten! A propos - wie sähe es denn mit einem schwedischen Komponisten aus…? ;-)
Nielsens Ouvertüre, die – der Name des griechischen Sonnengottes lässt es schon vermuten – einen sommerlichen Tag von Sonnenauf- bis –untergang in leuchtenden Orchesterfarben beschreibt, hat mir auch sehr gut gefallen, gerade die freudig-festliche Stimmung, die er erzeugt, wenn die Sonne zu Beginn des Stückes aufgeht, erzeugte schon einen gewissen Gänsehauteffekt! Ich kannte diese Ouvertüre bislang noch gar nicht, sie bestätigte aber meine positive Einstellung gegenüber diesem Komponisten, von dem ich bislang vor allem seine grandiosen Symphonien schätze!
Die junge Violinistin Patricia Kopatchinskaja aus Moldawien bot eine aus meiner Sicht etwas übertriebene (vom besetzungstechnisch stark reduzierten Gürzenich-Orchester gleichwohl souverän begleitete) Interpretation von Mozarts bekanntem 4. Violinkonzert. Sie trat barfuß im bodenlangen Kleid auf und ging vom ersten Takt der Orchestereinleitung an total in der Musik auf: Sie bewegte sich rhythmisch, drehte sich gerne während des Spiels auch einmal zu den hinter ihr sitzenden Orchestermusikern um und unterstrich ihr engagiertes Spiel mit entsprechenden Körperbewegungen - da wurde dann im Affekt auch mal mit dem Fuß aufgestampft, um einer rhythmischen Phrase (die sie gern auch mit entsprechend dynamischem Nachdruck einleitete) weitere Bedeutung zu verleihen.
Für mich machte diese Performance ständig den Eindruck, als wollte die Solistin ihrem Publikum quasi permanent mitteilen, wie leicht, unterhaltsam, „fluffig“ und modern Mozarts Musik doch ist und wieviel Spaß man beim Musizieren dieses in der Tat ja wirklich als reine Unterhaltungsmusik konzipierten Konzerts haben kann…
Ihre (wohl selbst verfassten) Solokadenzen – vor allem die am Ende des ersten Satzes – wirkten eher wie Vorführungen zum Thema „Was kann man aus einer einfachen Geige alles für Klänge herausholen?“, da wurde mit dem Bogen hantiert und abwechselnd dazu mit den Fingern gezupft, was das Zeug hielt! Stilistisch hatte dies jedenfalls mit dem Mozartkonzert nicht mehr allzuviel zu tun (mich erinnerte das Ganze eher an Kunststückchen à la Paganini, bzw. noch viel mehr an zeitgenössische Violinmusik) – gerade die ausgedehnte Kadenz des ersten Satzes stand von ihrer Länge her in keinem Verhältnis zur Länge desselben, noch dazu zerfiel sie in viele kleine artistische Einzelepisoden (jedenfalls habe ich das so empfunden) und der große Bogen fehlte hier einfach.
Patricia Kopatchinskaja verfügt über einen schönen und schlanken Geigenton, den sie wenigstens in den gesanglich-lyrischen Passagen des zweiten Satzes ohne die oben geschilderten „Zutaten“ voll zur Geltung kommen ließ.
Wie gesagt – für mich war diese Darbietung zwar engagiert aber für meinen Geschmack einfach zuviel des Guten! Mozarts Musik hat solche „Unterstützung“ gar nicht nötig – sie erzielt ihre beabsichtigte Wirkung auch ohne das ständige Überbetonen rhythmisch-schwungvoller Solisteneinsätze und den häufigen Wechsel von laut zu leise (und umgekehrt) innerhalb einer einzigen Phrase.
Und meine Meinung zu stilistisch fragwürdigen, zeitlich ausufernden Solokadenzen habe ich an anderer Stelle ja schon einmal kundgetan…
Laut Programmheft fühlt sich Frau Kopatchinskaja vor allem in der zeitgenössischen Musik zuhause, so haben mehrere Komponisten bereits Werke für sie geschrieben. Ganz ehrlich – das hat man der Solistin in jeder Phrase angemerkt! Ihre kurze Solo-Zugabe, die sie dem trotz allem begeisterten Publikum darbot, passte dann auch viel besser zu ihrer ganzen Persönlichkeit als das gesamte zuvor absolvierte Mozart-Konzert: Ein wild-virtuoser Ausbruch, bei dem die Solistin – wie in den Solokadenzen zuvor –abwechselnd die Saiten ihres Instruments mit Bogen und Fingern traktierte und der Geige die abenteuerlichsten Geräusche entlockte, das Ganze begleitet mit vokalen Gurr-, Quietsch-, Brabbel- und Zischlauten. So schräg diese (höchstens zweiminütige) Performance wirkte – irgendwie hatte das etwas, nicht zuletzt, weil man das Gefühl hatte, dass die Künstlerin hier endlich ihre zuvor nur mühsam angelegten Temperamentsbremsen endlich lösen und ganz aus sich herausgehen konnte.
Hätte man nicht für alle Beteiligten ein deutlich mitreißenderes Konzerterlebnis erzielt, wenn man Patricia Kopatchinskaja ein zeitgenössisches Werk hätte aufführen lassen, statt sie ausgerechnet mit Mozart „zähmen“ zu wollen? Das wäre bestimmt spannend geworden, denn ich kann mir vorstellen, dass sie hier wirklich eine überzeugende, mit Herzblut agierende Sachwalterin für diese ja nicht immer so einfach zu verstehende Musik ist.
Der Programmzettel des Abends sah wie folgt aus:
Carl Nielsen (1865-1931)
„Helios“ Ouvertüre für Orchester op. 17
W. A. Mozart (1756-91)
Konzert für Violine und Orchester Nr. 4 D-Dur KV 218
Richard Strauss (1864-1949)
„Sinfonia domestica“ für großes Orchester F-Dur op. 53
Patricia Kopatchinskaja, Violine
Gürzenich-Orchester Köln
Dirigent: Ulf Schirmer
Wie eigentlich alle Konzerte des Gürzenich-Orchesters, die ich in der letzten Zeit besucht habe (siehe meine entsprechenden Konzertberichte in diesem Blog), war auch dieses wieder erfreulich gut besucht: In der zu gut 80% ausgelasteten Kölner Philharmonie sah man auch eine ganze Reihe junger Konzertbesucher – sowas freut mich natürlich immer ganz besonders!
Abgesehen davon, dass ich das Programm des Abends ein bisschen wahllos zusammengestellt fand (immerhin sind die Kompositionen von Nielsen und Strauss im selben Jahr 1903 entstanden), gab es an der Leistung des gut aufgelegten Gürzenich-Orchesters nichts auszusetzen.
Vor allem die Strauss-Symphonie, die den 2. Teil des Konzertabends füllte, ließ keine Wünsche offen: Es macht einfach Spaß, ein üppig besetztes, mehr als 100-köpfiges Orchester beim Musizieren beobachten zu können und in den Live-Genuss der sich hieraus ergebenden üppigen Klänge zu kommen! Strauss‘ Tondichtung ist ein sehr dankbares Orchesterstück (in dem Strauss sein Familien- und Eheleben teils augenzwinkernd, teils mit großer Gefühlsgeste in Musik umsetzt), das wirklich alle Stimmgruppen des spätromantischen Orchesterapparats zur Geltung kommen lässt und bei dem ein Spitzenorchester zeigen kann, was alles in ihm steckt!
Ähnlich groß besetzt (aber nicht ganz so üppig wie bei Strauss) war das Gürzenich-Orchester bei der einleitenden Konzertouvertüre „Helios“ des dänischen Komponisten Carl Nielsen. Nielsen dürfte neben Niels Wilhelm Gade (1817-90) wohl der auch im Ausland bekannteste Komponist Dänemarks sein – nützlich für den Fall, dass man mal nach einem dänischen Komponisten gefragt wird und einem nur Namen wie Edvard Grieg (Norwegen) oder Jean Sibelius (Finnland) einfallen sollten! A propos - wie sähe es denn mit einem schwedischen Komponisten aus…? ;-)
Nielsens Ouvertüre, die – der Name des griechischen Sonnengottes lässt es schon vermuten – einen sommerlichen Tag von Sonnenauf- bis –untergang in leuchtenden Orchesterfarben beschreibt, hat mir auch sehr gut gefallen, gerade die freudig-festliche Stimmung, die er erzeugt, wenn die Sonne zu Beginn des Stückes aufgeht, erzeugte schon einen gewissen Gänsehauteffekt! Ich kannte diese Ouvertüre bislang noch gar nicht, sie bestätigte aber meine positive Einstellung gegenüber diesem Komponisten, von dem ich bislang vor allem seine grandiosen Symphonien schätze!
Die junge Violinistin Patricia Kopatchinskaja aus Moldawien bot eine aus meiner Sicht etwas übertriebene (vom besetzungstechnisch stark reduzierten Gürzenich-Orchester gleichwohl souverän begleitete) Interpretation von Mozarts bekanntem 4. Violinkonzert. Sie trat barfuß im bodenlangen Kleid auf und ging vom ersten Takt der Orchestereinleitung an total in der Musik auf: Sie bewegte sich rhythmisch, drehte sich gerne während des Spiels auch einmal zu den hinter ihr sitzenden Orchestermusikern um und unterstrich ihr engagiertes Spiel mit entsprechenden Körperbewegungen - da wurde dann im Affekt auch mal mit dem Fuß aufgestampft, um einer rhythmischen Phrase (die sie gern auch mit entsprechend dynamischem Nachdruck einleitete) weitere Bedeutung zu verleihen.
Für mich machte diese Performance ständig den Eindruck, als wollte die Solistin ihrem Publikum quasi permanent mitteilen, wie leicht, unterhaltsam, „fluffig“ und modern Mozarts Musik doch ist und wieviel Spaß man beim Musizieren dieses in der Tat ja wirklich als reine Unterhaltungsmusik konzipierten Konzerts haben kann…
Ihre (wohl selbst verfassten) Solokadenzen – vor allem die am Ende des ersten Satzes – wirkten eher wie Vorführungen zum Thema „Was kann man aus einer einfachen Geige alles für Klänge herausholen?“, da wurde mit dem Bogen hantiert und abwechselnd dazu mit den Fingern gezupft, was das Zeug hielt! Stilistisch hatte dies jedenfalls mit dem Mozartkonzert nicht mehr allzuviel zu tun (mich erinnerte das Ganze eher an Kunststückchen à la Paganini, bzw. noch viel mehr an zeitgenössische Violinmusik) – gerade die ausgedehnte Kadenz des ersten Satzes stand von ihrer Länge her in keinem Verhältnis zur Länge desselben, noch dazu zerfiel sie in viele kleine artistische Einzelepisoden (jedenfalls habe ich das so empfunden) und der große Bogen fehlte hier einfach.
Patricia Kopatchinskaja verfügt über einen schönen und schlanken Geigenton, den sie wenigstens in den gesanglich-lyrischen Passagen des zweiten Satzes ohne die oben geschilderten „Zutaten“ voll zur Geltung kommen ließ.
Wie gesagt – für mich war diese Darbietung zwar engagiert aber für meinen Geschmack einfach zuviel des Guten! Mozarts Musik hat solche „Unterstützung“ gar nicht nötig – sie erzielt ihre beabsichtigte Wirkung auch ohne das ständige Überbetonen rhythmisch-schwungvoller Solisteneinsätze und den häufigen Wechsel von laut zu leise (und umgekehrt) innerhalb einer einzigen Phrase.
Und meine Meinung zu stilistisch fragwürdigen, zeitlich ausufernden Solokadenzen habe ich an anderer Stelle ja schon einmal kundgetan…
Laut Programmheft fühlt sich Frau Kopatchinskaja vor allem in der zeitgenössischen Musik zuhause, so haben mehrere Komponisten bereits Werke für sie geschrieben. Ganz ehrlich – das hat man der Solistin in jeder Phrase angemerkt! Ihre kurze Solo-Zugabe, die sie dem trotz allem begeisterten Publikum darbot, passte dann auch viel besser zu ihrer ganzen Persönlichkeit als das gesamte zuvor absolvierte Mozart-Konzert: Ein wild-virtuoser Ausbruch, bei dem die Solistin – wie in den Solokadenzen zuvor –abwechselnd die Saiten ihres Instruments mit Bogen und Fingern traktierte und der Geige die abenteuerlichsten Geräusche entlockte, das Ganze begleitet mit vokalen Gurr-, Quietsch-, Brabbel- und Zischlauten. So schräg diese (höchstens zweiminütige) Performance wirkte – irgendwie hatte das etwas, nicht zuletzt, weil man das Gefühl hatte, dass die Künstlerin hier endlich ihre zuvor nur mühsam angelegten Temperamentsbremsen endlich lösen und ganz aus sich herausgehen konnte.
Hätte man nicht für alle Beteiligten ein deutlich mitreißenderes Konzerterlebnis erzielt, wenn man Patricia Kopatchinskaja ein zeitgenössisches Werk hätte aufführen lassen, statt sie ausgerechnet mit Mozart „zähmen“ zu wollen? Das wäre bestimmt spannend geworden, denn ich kann mir vorstellen, dass sie hier wirklich eine überzeugende, mit Herzblut agierende Sachwalterin für diese ja nicht immer so einfach zu verstehende Musik ist.
Donnerstag, 15. Dezember 2011
Gestern im Konzert: Hans Liberg in Düsseldorf
Irgendwie habe ich dieses Jahr wirklich Glück mit Gelegenheiten, kostenlos an Karten für interessante Konzerte zu kommen! Nachdem ich Anfang des Jahres mehrfach als "Vertretung" eine Abokarte für Konzerte des Kölner Gürzenichorchesters nutzen konnte, hatte ich nun gestern Abend das Glück, dass ich mit einem Kollegen zu einem Abend mit Hans Liberg in die Düsseldorfer Tonhalle gehen konnte (er hatte 2 Karten gewonnen und suchte noch nach einer Begleitung)!

Foto: © Thomas Mayer
Hans Liberg kannte ich bislang nur von kurzen TV-Ausschnitten aus seinen diversen Programmen und ich hatte mir schon seit einiger Zeit vorgenommen, ihn mal live zu erleben - umso schöner, dass sich das Ganze nun auf diese Art und Weise ergeben hat!
Wie soll man Hans Liberg und das, was er auf der Bühne so macht, beschreiben?
Schwierig - mir fällt nicht einmal eine passende "Berufsbezeichnung" für den 57-jährigen Niederländer (und gebürtigen Amsterdamer) ein: Musik-Kabarettist oder Musik-Komödiant, Multi-Instrumentalist, Jazz- und Klassik-Entertainer - das wären so am ehesten noch Charakterisierungen, die einem zu diesem ziemlich singulären Künstler in den Sinn kämen, ohne jedoch das Gesamt-Phänomen Hans Liberg wirklich treffend und umfassend zu beschreiben. Man muss ihn einfach mal in Aktion erlebt haben, um die Faszination, die von ihm ausgeht, wirklich verstehen zu können.
Klassik, Jazz, Rock, Pop, Kinder- und Volkslieder, TV-Melodien, Werbejingles - alles, was sich irgendwie als Musik bezeichnen lässt, ist für Hans Liberg eine einzige große, genreübergreifende Spielwiese, auf der er sich, einmal in Fahrt gekommen (und das passiert bei diesem Energiebündel eigentlich ab der ersten Minute auf der Bühne) mit geradezu irrwitziger Geschwindigkeit und verblüffender Leichtigkeit tummelt, wie eine wildgewordene Hummel.
Eine Melodie jagt die nächste, da wird scheinbar mühelos das zusammengefügt, was nüchtern betrachtet eigentlich überhaupt nicht zusammenzugehören scheint (wer hätte z. B. gedacht, dass es verblüffende Gemeinsamkeiten zwischen "Fuchs, du hast die Gans gestohlen", Smetanas "Moldau" und dem Beginn der israelischen Nationalhymne gibt?), wenn Liberg einmal am Flügel sitzt und schwungvoll in die Tasten haut, dann kommt man kaum noch hinterher, so flink sprühen die Ideen, werden Melodiezitate aneinandergereiht, zusammengefügt, variiert, verjazzt, verrockt - die zweieinhalb Stunden (inkl. einer knapp 20-minütigen Pause) gestern Abend vergingen wie im Fluge!
Und Liberg bearbeitet nicht nur den Flügel, er beherrscht auch noch zahlreiche andere Instrumente - gestern bekamen wir Kostproben seiner Fähigkeiten am Banjo, der E-Gitarre, der Blockflöte und der Snare Drum geboten.
Sein musikalischer Vortrag wird zeitweise ergänzt durch zwei Kollegen am Kontrabass und am Schlagzeug - in dieser klassischen Jazzbesetzung fühlt man sich während mancher Nummer plötzlich, als würde man dem Jacques Loussier-Trio bei einer seiner legendären "Play Bach"-Sessions lauschen! Diese Flexibilität, Virtuosität und Improvisationsfähigkeit im musikalischen Bereich ist natürlich unbedingte Voraussetzung für das gesamte Konzept, in rasendem Tempo von einem Thema zum nächsten springen zu können (mich würde interessieren, wie sehr eine der zurzeit wieder fast allabendlich an anderen Orten in Deutschland und den Niederlanden stattfindenden Shows der anderen gleicht?!) - das sieht alles so leichthändig und spielerisch aus, dass man fast sofort vergisst, wie viel Arbeit hinter dem Ganzen stecken muss!
Zwischen den zahllosen musikalischen Einlagen moderiert Hans Liberg wie selbstverständlich auf Deutsch (und spricht dabei mit deutlich weniger Akzent als es z. B. Rudi Carrell oder Marijke Amado je getan haben), bezieht fast pausenlos das Publikum mit ein (Mitsingen ist absolut erwünscht!) und bringt es sogar noch fertig, aktuelle politische Seitenhiebe (wohlgemerkt auf deutsche, nicht auf niederländische Politiker und Parteien) und lokale Anspielungen (in diesem Fall also über die Düsseldorfer und die Nachbarn aus Köln und Neuss) einfließen zu lassen - Respekt!
In seinem aktuellen Programm "Ick Hans Liberg" gibt es außerdem eine Szene, in der sich Liberg mit seinem Alter-Ego in Marionettengestalt kabbelt und mehrere größere und kleinere Tanzeinlagen, zu denen auch ein weiterer Assistent (der von Liberg als "Praktikant" und Freund seines Sohnes, der "unbedingt mal auf die Bühne wollte" vorgestellt wurde) seinen - teilweise recht akrobatischen - Beitrag abliefert.

Foto: © Thomas Mayer
Der Bezug zur Klassik bleibt aber bei allen Einlagen und musikalischen Ausflügen wie eh und je der Dreh- und Angelpunkt in Libergs Programm und sein Publikum ist auf diesem Gebiet durchaus sachkundig, auch, wenn es mal etwas kniffligere Themen und Melodien (jenseits von "Für Elise" oder "Eine kleine Nachtmusik") zu erraten gibt.
Sehr schön die Definition der gerade von Schubert gepflegten Gattung des Impromptus: "Eine Komposition, bei der der Komponist keine Ahnung hat, wie sie ausgehen wird!" - am Beispiel von Chopins "Tristesse"-Etüde op. 10 Nr. 3 wird das sogleich vorgeführt - das berühmte Thema geht nach kurzer Zeit nahtlos in "Strangers in the night" über und man hat beim Zuhören das Gefühl, dass das Ganze eigentlich nur so und nicht anders klingen müsste…
Auch der Hinweis, dass die englische Bezeichnung für die Tonart B-Dur ja "B flat" lautet, was übersetzt nichts anderes als "sei flach!" bedeutet (woraus man nun einige aufschlussreiche Schlussfolgerungen ziehen kann), war ebenso vergnüglich, wie die zahlreichen Beispiele, mit denen Liberg demonstrierte, dass Komponisten aller Jahrhunderte immer wieder munter voneinander abgekupfert haben (auch die Älteren von den zum Teil deutlich später Geborenen…), oder die eindrückliche Vorführung des Fakts, dass auch die besten Melodien nichts taugen, wenn man sie immer und immer wieder stumpfsinnig aneinanderreiht - jedenfalls, solange dazu noch Platz auf der Klaviatur (nach oben wie nach unten) ist…!
Als zweite Zugabe gab es dann noch eine sehr treffende Parodie der kanadischen Klavierlegende Glenn Gould - inklusive klapprigem Holzschemel, dem obligatorischen Mitsingen während des Vortrags (natürlich der Beginn der Goldberg-Variationen von Bach - das Stück, mit dem Glenn Gould wohl am bekanntesten geworden ist) und der absonderlichen Körperhaltung während des Spiels, wo trotz dicht über die Tastatur gebeugtem Kopf der ein oder andere mit äußerster Vorsicht hingetupfte Ton schon mal verloren gehen kann… ganz wunderbar!
Ein wirklich amüsanter Abend, der viel zu schnell vorüberging - die aktuelle Liberg-Tour geht noch bis zum Mai 2012 und führt durch diverse Städte, wer Spaß an geistreich-musikalischem Humor in der Tradition von legendären Künstlern wie Gerard Hoffnung oder Victor Borge hat und mit dem Namen Hans Liberg bislang noch nichts anfangen konnte, sollte sich unbedingt einmal eine seiner Shows ansehen!

Foto: © Thomas Mayer
Hans Liberg kannte ich bislang nur von kurzen TV-Ausschnitten aus seinen diversen Programmen und ich hatte mir schon seit einiger Zeit vorgenommen, ihn mal live zu erleben - umso schöner, dass sich das Ganze nun auf diese Art und Weise ergeben hat!
Wie soll man Hans Liberg und das, was er auf der Bühne so macht, beschreiben?
Schwierig - mir fällt nicht einmal eine passende "Berufsbezeichnung" für den 57-jährigen Niederländer (und gebürtigen Amsterdamer) ein: Musik-Kabarettist oder Musik-Komödiant, Multi-Instrumentalist, Jazz- und Klassik-Entertainer - das wären so am ehesten noch Charakterisierungen, die einem zu diesem ziemlich singulären Künstler in den Sinn kämen, ohne jedoch das Gesamt-Phänomen Hans Liberg wirklich treffend und umfassend zu beschreiben. Man muss ihn einfach mal in Aktion erlebt haben, um die Faszination, die von ihm ausgeht, wirklich verstehen zu können.
Klassik, Jazz, Rock, Pop, Kinder- und Volkslieder, TV-Melodien, Werbejingles - alles, was sich irgendwie als Musik bezeichnen lässt, ist für Hans Liberg eine einzige große, genreübergreifende Spielwiese, auf der er sich, einmal in Fahrt gekommen (und das passiert bei diesem Energiebündel eigentlich ab der ersten Minute auf der Bühne) mit geradezu irrwitziger Geschwindigkeit und verblüffender Leichtigkeit tummelt, wie eine wildgewordene Hummel.
Eine Melodie jagt die nächste, da wird scheinbar mühelos das zusammengefügt, was nüchtern betrachtet eigentlich überhaupt nicht zusammenzugehören scheint (wer hätte z. B. gedacht, dass es verblüffende Gemeinsamkeiten zwischen "Fuchs, du hast die Gans gestohlen", Smetanas "Moldau" und dem Beginn der israelischen Nationalhymne gibt?), wenn Liberg einmal am Flügel sitzt und schwungvoll in die Tasten haut, dann kommt man kaum noch hinterher, so flink sprühen die Ideen, werden Melodiezitate aneinandergereiht, zusammengefügt, variiert, verjazzt, verrockt - die zweieinhalb Stunden (inkl. einer knapp 20-minütigen Pause) gestern Abend vergingen wie im Fluge!
Und Liberg bearbeitet nicht nur den Flügel, er beherrscht auch noch zahlreiche andere Instrumente - gestern bekamen wir Kostproben seiner Fähigkeiten am Banjo, der E-Gitarre, der Blockflöte und der Snare Drum geboten.
Sein musikalischer Vortrag wird zeitweise ergänzt durch zwei Kollegen am Kontrabass und am Schlagzeug - in dieser klassischen Jazzbesetzung fühlt man sich während mancher Nummer plötzlich, als würde man dem Jacques Loussier-Trio bei einer seiner legendären "Play Bach"-Sessions lauschen! Diese Flexibilität, Virtuosität und Improvisationsfähigkeit im musikalischen Bereich ist natürlich unbedingte Voraussetzung für das gesamte Konzept, in rasendem Tempo von einem Thema zum nächsten springen zu können (mich würde interessieren, wie sehr eine der zurzeit wieder fast allabendlich an anderen Orten in Deutschland und den Niederlanden stattfindenden Shows der anderen gleicht?!) - das sieht alles so leichthändig und spielerisch aus, dass man fast sofort vergisst, wie viel Arbeit hinter dem Ganzen stecken muss!
Zwischen den zahllosen musikalischen Einlagen moderiert Hans Liberg wie selbstverständlich auf Deutsch (und spricht dabei mit deutlich weniger Akzent als es z. B. Rudi Carrell oder Marijke Amado je getan haben), bezieht fast pausenlos das Publikum mit ein (Mitsingen ist absolut erwünscht!) und bringt es sogar noch fertig, aktuelle politische Seitenhiebe (wohlgemerkt auf deutsche, nicht auf niederländische Politiker und Parteien) und lokale Anspielungen (in diesem Fall also über die Düsseldorfer und die Nachbarn aus Köln und Neuss) einfließen zu lassen - Respekt!
In seinem aktuellen Programm "Ick Hans Liberg" gibt es außerdem eine Szene, in der sich Liberg mit seinem Alter-Ego in Marionettengestalt kabbelt und mehrere größere und kleinere Tanzeinlagen, zu denen auch ein weiterer Assistent (der von Liberg als "Praktikant" und Freund seines Sohnes, der "unbedingt mal auf die Bühne wollte" vorgestellt wurde) seinen - teilweise recht akrobatischen - Beitrag abliefert.

Foto: © Thomas Mayer
Der Bezug zur Klassik bleibt aber bei allen Einlagen und musikalischen Ausflügen wie eh und je der Dreh- und Angelpunkt in Libergs Programm und sein Publikum ist auf diesem Gebiet durchaus sachkundig, auch, wenn es mal etwas kniffligere Themen und Melodien (jenseits von "Für Elise" oder "Eine kleine Nachtmusik") zu erraten gibt.
Sehr schön die Definition der gerade von Schubert gepflegten Gattung des Impromptus: "Eine Komposition, bei der der Komponist keine Ahnung hat, wie sie ausgehen wird!" - am Beispiel von Chopins "Tristesse"-Etüde op. 10 Nr. 3 wird das sogleich vorgeführt - das berühmte Thema geht nach kurzer Zeit nahtlos in "Strangers in the night" über und man hat beim Zuhören das Gefühl, dass das Ganze eigentlich nur so und nicht anders klingen müsste…
Auch der Hinweis, dass die englische Bezeichnung für die Tonart B-Dur ja "B flat" lautet, was übersetzt nichts anderes als "sei flach!" bedeutet (woraus man nun einige aufschlussreiche Schlussfolgerungen ziehen kann), war ebenso vergnüglich, wie die zahlreichen Beispiele, mit denen Liberg demonstrierte, dass Komponisten aller Jahrhunderte immer wieder munter voneinander abgekupfert haben (auch die Älteren von den zum Teil deutlich später Geborenen…), oder die eindrückliche Vorführung des Fakts, dass auch die besten Melodien nichts taugen, wenn man sie immer und immer wieder stumpfsinnig aneinanderreiht - jedenfalls, solange dazu noch Platz auf der Klaviatur (nach oben wie nach unten) ist…!
Als zweite Zugabe gab es dann noch eine sehr treffende Parodie der kanadischen Klavierlegende Glenn Gould - inklusive klapprigem Holzschemel, dem obligatorischen Mitsingen während des Vortrags (natürlich der Beginn der Goldberg-Variationen von Bach - das Stück, mit dem Glenn Gould wohl am bekanntesten geworden ist) und der absonderlichen Körperhaltung während des Spiels, wo trotz dicht über die Tastatur gebeugtem Kopf der ein oder andere mit äußerster Vorsicht hingetupfte Ton schon mal verloren gehen kann… ganz wunderbar!
Ein wirklich amüsanter Abend, der viel zu schnell vorüberging - die aktuelle Liberg-Tour geht noch bis zum Mai 2012 und führt durch diverse Städte, wer Spaß an geistreich-musikalischem Humor in der Tradition von legendären Künstlern wie Gerard Hoffnung oder Victor Borge hat und mit dem Namen Hans Liberg bislang noch nichts anfangen konnte, sollte sich unbedingt einmal eine seiner Shows ansehen!
Donnerstag, 7. Juli 2011
Philharmonie-Konzert
Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr bin ich diese Woche Dienstag (5. Juli) ganz spontan und überraschend an eine Karte für ein Symphoniekonzert des Kölner Gürzenich-Orchesters in der Philharmonie gekommen.
Folgendes stand auf dem Programm:
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur op. 73
Gustav Mahler (1860-1911)
Symphonie Nr. 1 D-Dur
Martin Helmchen, Klavier
Gürzenich-Orchester Köln
Dirigent: Markus Stenz
Mit diesem 12. Symphoniekonzert beschließt das Gürzenich-Orchester seine Konzertsaison 2010/ 2011 - Mitte Oktober beginnt dann die neue Konzertsaison 2011/ 2012.
Obwohl das Konzert am Dienstag der übliche dritte Konzerttermin mit dem oben genannten Programm war (am 3. und 4. Juli fanden bereits ebenfalls Konzerte statt), schien der Publikumszuspruch ungebrochen: Die Philharmonie war tatsächlich ausverkauft, was ich nun auch noch nicht so oft erlebt habe, zumal es sich ja um kein außergewöhnliches "Event" mit irgendwelchen gastierenden Weltstars handelte, sondern "lediglich" um ein reguläres Symphoniekonzert, für das auch zahlreiche Abonnenten ihre Dauerkarten besitzen!
So überraschend die Tatsache war, dass der Konzertsaal tatsächlich bis auf den letzten Platz besetzt war, so erfreulich war das Ganze natürlich (nicht nur für die Künstler): Weder der laue Sommerabend noch das zeitgleich stattfindende Frauen-Fußball-WM-Deutschlandspiel konnten die Konzertbesucher vom Philharmoniebesuch abhalten - auffallend dazu außerdem der verhältnismäßig hohe Anteil junger Leute im Publikum: Nicht nur die unter 30-jährigen, sogar die sehr deutlich vertretenen unter 20-jährigen Zuhörer lassen hoffen, dass das Interesse auch der jüngeren Generation an klassischen Symphoniekonzerten durchaus vorhanden ist - ich habe hier jedenfalls viele sehr aufmerksame und ausgesprochen zufriedene Gesichter während und nach dem Konzert beobachten können.
Und es gab auch jede Menge Gründe, von diesem Konzert begeistert zu sein - das attraktive Programm schien ja bereits wie ein Publikumsmagnet gewirkt zu haben, die überzeugende, ja mitreißende Leistung von Solist, Orchester und Dirigent taten dann ein Übriges!
Den sympathischen 29-jährigen Solisten Martin Helmchen aus Berlin kannte ich bereits von einigen CD-Aufnahmen - im Konzert habe ich ihn am Dienstag erstmalig erleben dürfen (es war zugleich auch sein Debüt mit dem Kölner Gürzenich-Orchester). Helmchen, dessen pianistischer Schwerpunkt wohl im Bereich der Wiener Klassik sowie bei Schubert, Schumann und Brahms liegen dürfte, überzeugte durch sein auf die große Virtuosenattitüde verzichtendes Spiel - so etwas würde wohl auch besser zur Musik von Tschaikowsky oder Rachmaninoff und nun wirklich nicht zu Beethoven & Co. passen. Er gestaltete den anspruchsvollen Klavierpart des 5. Klavierkonzerts (uraufgeführt im Jahr 1809) klar, präzise und schwungvoll, mit der nötigen Eleganz (z. B. direkt zu Beginn des ersten Satzes) und einem guten Gespür für die zarten und leisen Töne, ohne hier zu sehr ins Sentimentale oder Romantisierende abzugleiten, obwohl gerade der Beginn des zweiten Satzes, eines der wohl lyrischsten Satzanfänge, die Beethoven je komponiert hat, zu einer solchen Interpretation verleiten würde. Aber wie der weitere Verlauf dieses zweiten Satzes dann zeigt, ist Beethoven weit davon entfernt, sich in einer quasi endlosen schwärmerischen Stimmung zu verlieren und dies ordentlich auszukosten, wie es z. B. in den langsamen Sätzen der beiden Klavierkonzerte von Chopin der Fall ist - aber diese Musik gehört ja dann auch schon in die Epoche der Romantik!
Mich hat jedenfalls Helmchens Interpretation - gerade auch dieses poetischen Anfangs des 2. Satzes - sehr angesprochen.
Auch die Interaktion zwischen Solist und Orchester klappte tadellos: Markus Stenz ließ dem Solisten an den Solostellen ausreichend Zeit und Gelegenheit, diese sorgfältig auszuspielen und keine drängende Hektik aufkommen zu lassen (es kommt ja vor, dass man mitunter den Eindruck hat, das zahlenmäßig überlegene Orchester würde den oder die Solist[in] vor sich her treiben…) - im Konzert am Dienstag musizierten jedenfalls zwei gleichberechtigte, einander auch klanglich absolut ebenbürtige Partner miteinander und nicht aneinander vorbei.
Das gewählte zügig-leichtfüßige Grundtempo und der transparente Orchesterklang passten gut zum Wiener Klassiker Beethoven (dessen Musik ja früher gerne deutlich schwerfälliger und irgendwie immer ganz besonders "bedeutungsgeschwängert" aufgeführt wurde!) - alles machte einen frischen und lebendigen Eindruck und wirkte im Ganzen wie eine wirklich "runde" Sache!
Als Zugabe und als Dank für den begeisterten Applaus spielte Martin Helmchen für uns noch den Satz "Vogel als Prophet" aus den Waldszenen op. 82 von Robert Schumann (1810-56).
Dass das Gürzenich-Orchester eine bis in die Entstehungszeit der Symphonien zurückreichende Mahler-Tradition besitzt, kann man in jedem Konzertführer nachschlagen - es ist eine erfreuliche Tatsache, dass auch aktuelle Aufführungen nach wie vor die Hingabe aller Beteiligten an und die Begeisterung für die Kompositionen von Gustav Mahler rüberbringen können.
Man spürte z. B. im pompös-wuchtigen Finale der 1. Symphonie geradezu die körperliche Kraft und Energie, die dieser Musik innewohnt - das Orchester hierbei zu beobachten war gleichermaßen faszinierend und begeisternd - im Publikum konnte sich niemand diesem Sog entziehen und was kann man Besseres von der Wiedergabe eines Musikstücks sagen, als wenn man feststellen muss, dass der berühmte "Funke" ganz offensichtlich übergesprungen und die musikalische Botschaft angekommen war?
Den berühmten dritten Satz der im Jahr 1889 uraufgeführten 1. Symphonie, dieser immer wieder in schwungvoll-groteske Klänge umkippende Trauermarsch über die in Moll erklingende Melodie des bekannten Kanons "Frère Jacques", fand ich besonders gelungen: Markus Stenz verstand es prächtig, die schmissigen Einwürfe, die die eigentlich ernste Stimmung des Satzes immer wieder ins Absurde, ja Komische abgleiten lassen, richtig schön auszukosten. Man spürte förmlich das Zukunftsweisende dieser Musik - hier wurde die Tür ins 20. Jahrhundert bereits weit aufgestoßen.
Aber auch schon im ersten Satz wurden die teilweise urplötzlich auftretenden Lautstärke- und Stimmungswechsel richtig schön plastisch und knackig ausgekostet - das eh schon groß besetzte Orchester konnte sich in dieser Symphonie wieder einmal so richtig "austoben" und zeigen, was für ein gut aufeinander eingespieltes Ensemble es darstellt. Vor allem die verschiedenen Blechbläser beeindruckten in diesem für sie so überaus dankbaren Werk (von zwei kleinen Patzern abgesehen) - sehr präsent und strahlend dominierten sie an den entsprechenden Stellen das Ganze und wenn dann im Finale des letzten Satzes traditionell die sieben Hornisten zur Steigerung des Gesamtklangs ihren Part im Stehen spielen, dann bekommt man schon eine Gänsehaut!
Schade, dass es diesmal keinen "3. Akt" gab, also den erst im Konzert selbst unmittelbar vorher bekanntgegebenen letzten Programmpunkt, der traditionell immer auf der Agenda steht, wenn Markus Stenz selber das Gürzenich-Orchester dirigiert. Aber was hätte nach diesem gewaltigen Schlusspunkt am Ende der 1. Symphonie noch kommen können, zumal die Musiker nach dieser "Schlacht" auch sichtlich erschöpft und erleichtert wirkten (und sich vielleicht auch schon auf die Sommerpause freuten, die jetzt wohl anstehen dürfte)?
Ich hätte mich gefreut, wenn auch der von Mahler ursprünglich vorgesehene, "Blumine" betitelte zweite Satz zur Aufführung gekommen wäre - gerade jetzt im "Mahler-Jahr". Man bekommt diesen Satz viel zu selten einmal zu Gehör und da hätte es sich doch angeboten anstatt des "3. Aktes" am Schluss des Konzerts den "Blumine"- Satz vielleicht ganz einfach an der ursprünglichen Stelle (wo er auch in der Uraufführung 1889 noch zu finden war) zu spielen?
Aber das soll den Eindruck dieses tollen Konzertabends nun wirklich nicht schmälern - ich bin noch immer ganz hin und weg und freue mich schon auf die neue Saison!
Folgendes stand auf dem Programm:
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur op. 73
Gustav Mahler (1860-1911)
Symphonie Nr. 1 D-Dur
Martin Helmchen, Klavier
Gürzenich-Orchester Köln
Dirigent: Markus Stenz
Mit diesem 12. Symphoniekonzert beschließt das Gürzenich-Orchester seine Konzertsaison 2010/ 2011 - Mitte Oktober beginnt dann die neue Konzertsaison 2011/ 2012.
Obwohl das Konzert am Dienstag der übliche dritte Konzerttermin mit dem oben genannten Programm war (am 3. und 4. Juli fanden bereits ebenfalls Konzerte statt), schien der Publikumszuspruch ungebrochen: Die Philharmonie war tatsächlich ausverkauft, was ich nun auch noch nicht so oft erlebt habe, zumal es sich ja um kein außergewöhnliches "Event" mit irgendwelchen gastierenden Weltstars handelte, sondern "lediglich" um ein reguläres Symphoniekonzert, für das auch zahlreiche Abonnenten ihre Dauerkarten besitzen!
So überraschend die Tatsache war, dass der Konzertsaal tatsächlich bis auf den letzten Platz besetzt war, so erfreulich war das Ganze natürlich (nicht nur für die Künstler): Weder der laue Sommerabend noch das zeitgleich stattfindende Frauen-Fußball-WM-Deutschlandspiel konnten die Konzertbesucher vom Philharmoniebesuch abhalten - auffallend dazu außerdem der verhältnismäßig hohe Anteil junger Leute im Publikum: Nicht nur die unter 30-jährigen, sogar die sehr deutlich vertretenen unter 20-jährigen Zuhörer lassen hoffen, dass das Interesse auch der jüngeren Generation an klassischen Symphoniekonzerten durchaus vorhanden ist - ich habe hier jedenfalls viele sehr aufmerksame und ausgesprochen zufriedene Gesichter während und nach dem Konzert beobachten können.
Und es gab auch jede Menge Gründe, von diesem Konzert begeistert zu sein - das attraktive Programm schien ja bereits wie ein Publikumsmagnet gewirkt zu haben, die überzeugende, ja mitreißende Leistung von Solist, Orchester und Dirigent taten dann ein Übriges!
Den sympathischen 29-jährigen Solisten Martin Helmchen aus Berlin kannte ich bereits von einigen CD-Aufnahmen - im Konzert habe ich ihn am Dienstag erstmalig erleben dürfen (es war zugleich auch sein Debüt mit dem Kölner Gürzenich-Orchester). Helmchen, dessen pianistischer Schwerpunkt wohl im Bereich der Wiener Klassik sowie bei Schubert, Schumann und Brahms liegen dürfte, überzeugte durch sein auf die große Virtuosenattitüde verzichtendes Spiel - so etwas würde wohl auch besser zur Musik von Tschaikowsky oder Rachmaninoff und nun wirklich nicht zu Beethoven & Co. passen. Er gestaltete den anspruchsvollen Klavierpart des 5. Klavierkonzerts (uraufgeführt im Jahr 1809) klar, präzise und schwungvoll, mit der nötigen Eleganz (z. B. direkt zu Beginn des ersten Satzes) und einem guten Gespür für die zarten und leisen Töne, ohne hier zu sehr ins Sentimentale oder Romantisierende abzugleiten, obwohl gerade der Beginn des zweiten Satzes, eines der wohl lyrischsten Satzanfänge, die Beethoven je komponiert hat, zu einer solchen Interpretation verleiten würde. Aber wie der weitere Verlauf dieses zweiten Satzes dann zeigt, ist Beethoven weit davon entfernt, sich in einer quasi endlosen schwärmerischen Stimmung zu verlieren und dies ordentlich auszukosten, wie es z. B. in den langsamen Sätzen der beiden Klavierkonzerte von Chopin der Fall ist - aber diese Musik gehört ja dann auch schon in die Epoche der Romantik!
Mich hat jedenfalls Helmchens Interpretation - gerade auch dieses poetischen Anfangs des 2. Satzes - sehr angesprochen.
Auch die Interaktion zwischen Solist und Orchester klappte tadellos: Markus Stenz ließ dem Solisten an den Solostellen ausreichend Zeit und Gelegenheit, diese sorgfältig auszuspielen und keine drängende Hektik aufkommen zu lassen (es kommt ja vor, dass man mitunter den Eindruck hat, das zahlenmäßig überlegene Orchester würde den oder die Solist[in] vor sich her treiben…) - im Konzert am Dienstag musizierten jedenfalls zwei gleichberechtigte, einander auch klanglich absolut ebenbürtige Partner miteinander und nicht aneinander vorbei.
Das gewählte zügig-leichtfüßige Grundtempo und der transparente Orchesterklang passten gut zum Wiener Klassiker Beethoven (dessen Musik ja früher gerne deutlich schwerfälliger und irgendwie immer ganz besonders "bedeutungsgeschwängert" aufgeführt wurde!) - alles machte einen frischen und lebendigen Eindruck und wirkte im Ganzen wie eine wirklich "runde" Sache!
Als Zugabe und als Dank für den begeisterten Applaus spielte Martin Helmchen für uns noch den Satz "Vogel als Prophet" aus den Waldszenen op. 82 von Robert Schumann (1810-56).
Dass das Gürzenich-Orchester eine bis in die Entstehungszeit der Symphonien zurückreichende Mahler-Tradition besitzt, kann man in jedem Konzertführer nachschlagen - es ist eine erfreuliche Tatsache, dass auch aktuelle Aufführungen nach wie vor die Hingabe aller Beteiligten an und die Begeisterung für die Kompositionen von Gustav Mahler rüberbringen können.
Man spürte z. B. im pompös-wuchtigen Finale der 1. Symphonie geradezu die körperliche Kraft und Energie, die dieser Musik innewohnt - das Orchester hierbei zu beobachten war gleichermaßen faszinierend und begeisternd - im Publikum konnte sich niemand diesem Sog entziehen und was kann man Besseres von der Wiedergabe eines Musikstücks sagen, als wenn man feststellen muss, dass der berühmte "Funke" ganz offensichtlich übergesprungen und die musikalische Botschaft angekommen war?
Den berühmten dritten Satz der im Jahr 1889 uraufgeführten 1. Symphonie, dieser immer wieder in schwungvoll-groteske Klänge umkippende Trauermarsch über die in Moll erklingende Melodie des bekannten Kanons "Frère Jacques", fand ich besonders gelungen: Markus Stenz verstand es prächtig, die schmissigen Einwürfe, die die eigentlich ernste Stimmung des Satzes immer wieder ins Absurde, ja Komische abgleiten lassen, richtig schön auszukosten. Man spürte förmlich das Zukunftsweisende dieser Musik - hier wurde die Tür ins 20. Jahrhundert bereits weit aufgestoßen.
Aber auch schon im ersten Satz wurden die teilweise urplötzlich auftretenden Lautstärke- und Stimmungswechsel richtig schön plastisch und knackig ausgekostet - das eh schon groß besetzte Orchester konnte sich in dieser Symphonie wieder einmal so richtig "austoben" und zeigen, was für ein gut aufeinander eingespieltes Ensemble es darstellt. Vor allem die verschiedenen Blechbläser beeindruckten in diesem für sie so überaus dankbaren Werk (von zwei kleinen Patzern abgesehen) - sehr präsent und strahlend dominierten sie an den entsprechenden Stellen das Ganze und wenn dann im Finale des letzten Satzes traditionell die sieben Hornisten zur Steigerung des Gesamtklangs ihren Part im Stehen spielen, dann bekommt man schon eine Gänsehaut!
Schade, dass es diesmal keinen "3. Akt" gab, also den erst im Konzert selbst unmittelbar vorher bekanntgegebenen letzten Programmpunkt, der traditionell immer auf der Agenda steht, wenn Markus Stenz selber das Gürzenich-Orchester dirigiert. Aber was hätte nach diesem gewaltigen Schlusspunkt am Ende der 1. Symphonie noch kommen können, zumal die Musiker nach dieser "Schlacht" auch sichtlich erschöpft und erleichtert wirkten (und sich vielleicht auch schon auf die Sommerpause freuten, die jetzt wohl anstehen dürfte)?
Ich hätte mich gefreut, wenn auch der von Mahler ursprünglich vorgesehene, "Blumine" betitelte zweite Satz zur Aufführung gekommen wäre - gerade jetzt im "Mahler-Jahr". Man bekommt diesen Satz viel zu selten einmal zu Gehör und da hätte es sich doch angeboten anstatt des "3. Aktes" am Schluss des Konzerts den "Blumine"- Satz vielleicht ganz einfach an der ursprünglichen Stelle (wo er auch in der Uraufführung 1889 noch zu finden war) zu spielen?
Aber das soll den Eindruck dieses tollen Konzertabends nun wirklich nicht schmälern - ich bin noch immer ganz hin und weg und freue mich schon auf die neue Saison!
Dienstag, 10. Mai 2011
Philharmonie-Konzert: Philippe Jaroussky
Als Fan der Barockoper faszinieren mich seit Jahren die unwirklich-androgyn klingenden Stimmen der Countertenöre, die sich nun schon seit ca. 40 Jahren mit einer sich immer weiter verfeinernden Gesangstechnik peu à peu die ursprünglich von Kastraten verkörperten Männerrollen zurückerobern. Zunächst eine Art Experiment (für das man durchaus bereit war, stimm- und klangtechnische Einbußen in Kauf zu nehmen), aufgrund der immer weiter verbesserten Ausbildung nachwachsender Sängergenerationen zunehmend jedoch eine fast schon als alternativlos zu bezeichnende Besetzungsoption für barocke Kastratenpartien (und für mich gerade live eine viel bessere Alternative zu den über viele Jahre in der Bühnenpraxis gewählten Hosenrollen oder gar dem "Tieferlegen" der Partie in Bariton- oder Basslage)!
Ein Vertreter der derzeit jüngsten Generation junger Countertenöre ist der Franzose Philippe Jaroussky (geb. 1978), der seit ungefähr 10 Jahren (angefüllt mit zahllosen Konzert- und Opernprojekten) von sich reden macht und sich - nicht zuletzt durch mehrere geschmackvoll zusammengestellte und sehr gelungene CD-Programme - eine mittlerweile offensichtlich recht große internationale Fangemeinde erobert hat.
Neben seiner sympathisch-jungenhaften Ausstrahlung fasziniert bei ihm in besonderem Maße seine - so jedenfalls mein Eindruck - in den letzten Jahren immer noch ein wenig heller und höher klingende Countertenor-Stimme: Sein Gesang klingt so völlig schwere- und mühelos, dass man sich wirklich fragt, wie er das bloß macht - er muss über eine stupende Technik, aber wohl auch über entsprechend günstige physische Voraussetzungen verfügen! Jedenfalls eine ideale Kombination, die es ihm ermöglicht, einen vom Alt bis in mittlere Sopranlagen reichenden Stimmmumfang ohne hörbares Forcieren oder sonstige Spuren von Anstrengung und Schärfe zu produzieren - ein wirkliches Faszinosum, dessen irritierend-klangschöner Wikung man sich nur schwer entziehen kann.
Nichts gegen Countertenöre, die eher etwas "erdiger" und kerniger und damit deutlich mehr nach "männlichem Alt" klingen - auch diese haben ihren Reiz und es wäre ja auch traurig, wenn alle Countertenöre einader nahezu unverwechselbar ähnlich klängen...
Jarousskys oben erwähnte, ausgesprochen abwechslungsreiche Diskographie, die neben dem obligatorischen 18. Jahrhundert erfreulicherweise auch eine ganze Menge Musik aus dem 17. Jahrhundert umfasst, wurde im Jahr 2009 (unter dem Titel "OPIUM") durch einen gänzlich unerwarteten Ausflug in das Genre des französischen Klavierlieds vom Ende des 19. Jahrhunderts um einen wirklich interessanten weiteren Mosaikstein bereichert.

Diese kleinen, meist recht knapp gefassten Preziosen stammen von namhaften (zum Teil aber auch heute ziemlich unbekannten) Komponisten des Fin de siècle wie Jules Massenet, Ernest Chausson, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Cécile Chaminade oder Reynaldo Hahn und sind durch ihre Konzeption für "Singstimme" und Klavier natürlich individuell vortragbar (und damit nicht auf eine bestimmte Stimmlage festgeschrieben).
Ich war sehr neugierig, Philippe Jaroussky einmal live im Konzert zu erleben (noch lieber aber eigentlich auf der Opernbühne!), um beurteilen zu können, ob er live genauso charismatisch und stimmlich mühelos rüberkommt, wie auf den CDs.
Also habe ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, als Jaroussky vergangenen Donnerstag (5. Mai) mit seinem "OPIUM"-Programm in der Kölner Philharmonie zu Gast war.
Zusmmen mit Jérôme Ducros, dem Pianisten, mit dem zusammen er sich dieses Programm erarbeitet hat (und der im Programmverlauf auch zwei Solostücke aus derselben Epoche präsentieren durfte), gab er dann vor fast ausverkauftem Haus ein wirklich gelungenes, engagiertes und teilweise sensibel-anrührendes knapp zweistündiges Konzert (inkl. Pause), in dessen Verlauf er immerhin 12 von 21 für die Besetzung Singstimme - Klavier komponierte Lieder seiner gleichnamigen CD zum Besten gab und diese Lieder dann erfreulicherweise durch zahlreiche weitere, so bislang noch nicht aufgenommene Stücke (z. B. auch aus Berlioz' "Nuits d'été") ergänzte.
Wenn es auch irritierend wirkte, dass auf der großen Bühne der Philharmonie, auf der sich normalerweise orchestrale Massen austoben dürfen, lediglich ein Flügel stand, neben dem sich Philippe Jaroussky postierte (und während seiner Gesangsvorträge sympathischerweise auch ohne allzu exaltiertes und ablenkendes Herumgestikulieren auskam!), so sorgte die gute Akustik der Kölner Philharmonie dafür, dass dieses zunächst ein bisschen "einsam" wirkende Duo sich klanglich ohne Abstriche in diesem riesigen Saal entfalten konnte, so dass ich eindeutig feststellen muss: Jawohl - auch im Konzert klingt Philippe Jaroussky genauso faszinierend, leuchtet seine schlanke Stimme scheinbar mühe- und makellos!
Gerade in den eher lyrisch-sentimentalen, ruhigeren Liedern (wie z. B. dem zarten "A Chloris" von Reynaldo Hahn aus dem Jahr 1916) schafften es Sänger und Pianist durch ihre subtile, nie kitschig wirkende Interpretation, eine fast schon intime Atmosphäre entstehen zu lassen, die einen nahezu vergessen ließ, dass man sich ja eigentlich im großen Konzertsaal der Kölner Philharmonie mit fast 2.000 anderen Zuhörern befand...
Das Auditorium war entsprechend begeistert und applaudierte frenetisch - und das Duo Jaroussky - Ducros ließ sich auf diese Weise zu immerhin drei Zugaben überreden :-)
In der letzten Zugabe, die Reprise des charmanten Liedes "Sombrero" von Cécile Chaminade, konnte man dann auch einmal Philippe Jarousskys "normale" Gesangsstimmlage erleben: Mit seinem hellen Tenor, den er in verschiedenen Phrasen dieses Liedes - quasi als Kontrast zum restlichen Vortrag in Countertenorlage - erklingen ließ, überraschte und erfreute er seine Zuhörer: Wann hat man schon einmal die Gelegenheit, quasi ein kleines "Duett" zwischen hoher und tiefer(er) Stimmlage, vorgetragen von nur einem Sänger, zu erleben?
Ein mitreißender, begeisternder Konzertabend mit einem charismatischen Sänger, auf dessen weiteren Karriereverlauf ich schon sehr gespannt bin!
Ein Vertreter der derzeit jüngsten Generation junger Countertenöre ist der Franzose Philippe Jaroussky (geb. 1978), der seit ungefähr 10 Jahren (angefüllt mit zahllosen Konzert- und Opernprojekten) von sich reden macht und sich - nicht zuletzt durch mehrere geschmackvoll zusammengestellte und sehr gelungene CD-Programme - eine mittlerweile offensichtlich recht große internationale Fangemeinde erobert hat.
Neben seiner sympathisch-jungenhaften Ausstrahlung fasziniert bei ihm in besonderem Maße seine - so jedenfalls mein Eindruck - in den letzten Jahren immer noch ein wenig heller und höher klingende Countertenor-Stimme: Sein Gesang klingt so völlig schwere- und mühelos, dass man sich wirklich fragt, wie er das bloß macht - er muss über eine stupende Technik, aber wohl auch über entsprechend günstige physische Voraussetzungen verfügen! Jedenfalls eine ideale Kombination, die es ihm ermöglicht, einen vom Alt bis in mittlere Sopranlagen reichenden Stimmmumfang ohne hörbares Forcieren oder sonstige Spuren von Anstrengung und Schärfe zu produzieren - ein wirkliches Faszinosum, dessen irritierend-klangschöner Wikung man sich nur schwer entziehen kann.
Nichts gegen Countertenöre, die eher etwas "erdiger" und kerniger und damit deutlich mehr nach "männlichem Alt" klingen - auch diese haben ihren Reiz und es wäre ja auch traurig, wenn alle Countertenöre einader nahezu unverwechselbar ähnlich klängen...
Jarousskys oben erwähnte, ausgesprochen abwechslungsreiche Diskographie, die neben dem obligatorischen 18. Jahrhundert erfreulicherweise auch eine ganze Menge Musik aus dem 17. Jahrhundert umfasst, wurde im Jahr 2009 (unter dem Titel "OPIUM") durch einen gänzlich unerwarteten Ausflug in das Genre des französischen Klavierlieds vom Ende des 19. Jahrhunderts um einen wirklich interessanten weiteren Mosaikstein bereichert.

Diese kleinen, meist recht knapp gefassten Preziosen stammen von namhaften (zum Teil aber auch heute ziemlich unbekannten) Komponisten des Fin de siècle wie Jules Massenet, Ernest Chausson, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Cécile Chaminade oder Reynaldo Hahn und sind durch ihre Konzeption für "Singstimme" und Klavier natürlich individuell vortragbar (und damit nicht auf eine bestimmte Stimmlage festgeschrieben).
Ich war sehr neugierig, Philippe Jaroussky einmal live im Konzert zu erleben (noch lieber aber eigentlich auf der Opernbühne!), um beurteilen zu können, ob er live genauso charismatisch und stimmlich mühelos rüberkommt, wie auf den CDs.
Also habe ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, als Jaroussky vergangenen Donnerstag (5. Mai) mit seinem "OPIUM"-Programm in der Kölner Philharmonie zu Gast war.
Zusmmen mit Jérôme Ducros, dem Pianisten, mit dem zusammen er sich dieses Programm erarbeitet hat (und der im Programmverlauf auch zwei Solostücke aus derselben Epoche präsentieren durfte), gab er dann vor fast ausverkauftem Haus ein wirklich gelungenes, engagiertes und teilweise sensibel-anrührendes knapp zweistündiges Konzert (inkl. Pause), in dessen Verlauf er immerhin 12 von 21 für die Besetzung Singstimme - Klavier komponierte Lieder seiner gleichnamigen CD zum Besten gab und diese Lieder dann erfreulicherweise durch zahlreiche weitere, so bislang noch nicht aufgenommene Stücke (z. B. auch aus Berlioz' "Nuits d'été") ergänzte.
Wenn es auch irritierend wirkte, dass auf der großen Bühne der Philharmonie, auf der sich normalerweise orchestrale Massen austoben dürfen, lediglich ein Flügel stand, neben dem sich Philippe Jaroussky postierte (und während seiner Gesangsvorträge sympathischerweise auch ohne allzu exaltiertes und ablenkendes Herumgestikulieren auskam!), so sorgte die gute Akustik der Kölner Philharmonie dafür, dass dieses zunächst ein bisschen "einsam" wirkende Duo sich klanglich ohne Abstriche in diesem riesigen Saal entfalten konnte, so dass ich eindeutig feststellen muss: Jawohl - auch im Konzert klingt Philippe Jaroussky genauso faszinierend, leuchtet seine schlanke Stimme scheinbar mühe- und makellos!
Gerade in den eher lyrisch-sentimentalen, ruhigeren Liedern (wie z. B. dem zarten "A Chloris" von Reynaldo Hahn aus dem Jahr 1916) schafften es Sänger und Pianist durch ihre subtile, nie kitschig wirkende Interpretation, eine fast schon intime Atmosphäre entstehen zu lassen, die einen nahezu vergessen ließ, dass man sich ja eigentlich im großen Konzertsaal der Kölner Philharmonie mit fast 2.000 anderen Zuhörern befand...
Das Auditorium war entsprechend begeistert und applaudierte frenetisch - und das Duo Jaroussky - Ducros ließ sich auf diese Weise zu immerhin drei Zugaben überreden :-)
In der letzten Zugabe, die Reprise des charmanten Liedes "Sombrero" von Cécile Chaminade, konnte man dann auch einmal Philippe Jarousskys "normale" Gesangsstimmlage erleben: Mit seinem hellen Tenor, den er in verschiedenen Phrasen dieses Liedes - quasi als Kontrast zum restlichen Vortrag in Countertenorlage - erklingen ließ, überraschte und erfreute er seine Zuhörer: Wann hat man schon einmal die Gelegenheit, quasi ein kleines "Duett" zwischen hoher und tiefer(er) Stimmlage, vorgetragen von nur einem Sänger, zu erleben?
Ein mitreißender, begeisternder Konzertabend mit einem charismatischen Sänger, auf dessen weiteren Karriereverlauf ich schon sehr gespannt bin!
Mittwoch, 6. April 2011
Philharmonie-Konzert
Gestern Abend hatte ich in diesem Jahr nun schon zum dritten Mal die spontane (und gern genutzte) Gelegenheit, ein Sinfoniekonzert des Gürzenich-Orchesters in der Kölner Philharmonie zu besuchen.
Auf dem Programm des insgesamt 8. Konzerts der laufenden Spielzeit standen folgende Werke:
Maurice Ravel (1875-1937)
"Ma Mère l'Oye" Suite für Orchester (1911)
Sergej Prokofjew (1891-1953)
Violinkonzert Nr. 1 D-Dur op. 19 (1916/17)
Nikolai Rimski-Korsakow (1844-1908)
Scheherazade op. 35
Sinfonische Suite aus "Tausendundeine Nacht" (1888)
Akiko Suwanai, Violine
Gürzenich-Orchester Köln
Dir.: Emmanuel Krivine
Alle drei Werke sind absolute Klassiker, die in den Jahren kurz vor und nach Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Die Zuhörer in der zu gut drei Viertel ausgebuchten Philharmonie konnten einen rundum gelungenen Konzertabend erleben mit einem engagierten Dirigenten, einer virtuosen Solistin und einem wirklich gut aufgelegten Orchester, so dass eigentlich keine Wünsche offen blieben!
Der französische Dirigent mit russisch-polnischen Wurzeln Emmanuel Krivine, der nach mehreren internationalen Stationen seit 2006 dem Philharmonischen Orchester Luxemburg vorsteht, fühlte sich begreiflicherweise neben dem französischen auch im russischen Repertoire des gestrigen Abends absolut heimisch und dirigierte den Prokofjew und den Rimski-Korsakow auswendig mit einem schwungvollen und dynamischen Stil - klare, weit ausholende Gesten, deren Entschlossenheit Musikern wie Publikum unmissverständlich vermittelte, dass sich der Maestro dieser Musik durch und durch verbunden fühlt!
Aber auch dem französischen Klangzauberer Ravel entlockte er zu Beginn in der kurzen fünfsätzigen "Mutter Gans"-Suite die erforderlichen klangprächtigen kindlich-fantasievollen Assoziationen, die zur Umsetzung der mit Märchenfiguren bevölkerten einzelnen Episoden erforderlich sind.
Die Violinistin Akiko Suwanai spielt auf einer Stradivari aus dem Jahr 1714, die sie als Leihgabe von der Nippon Music Foundation zur Verfügung gestellt bekommen hat. Es war wirklich beeindruckend zu erleben, welch raumfüllenden Klang dieses immerhin 300 Jahre alte Instrument besitzt - vor allem, als Akiko Suwanai als Zugabe nach dem bravourös absolvierten Prokofjew-Konzert eine kleine Solozugabe spielte (es handelte sich hierbei wohl um einen Satz aus einer der Partiten für Solovioline von Bach, in diesem Fall also um ein Stück, das genauso alt wie die Stradivari selber ist!): Der warme und klare Ton ihrer Geige drang mühelos noch in die letzte Ecke des riesigen Saales!
Aber auch zuvor hatte die Japanerin sich souverän über alle technischen Klippen des enorm schwierigen ersten Violinkonzerts von Prokofjew hinweggesetzt (die charakteristische "Violinentonart" D-Dur und die über weite Strecken sehr hoch geführte Solostimme hat dieses Konzert mit dem berühmten Beethoven-Konzert gemeinsam!) - allein schon der rasend schnelle Mittelsatz "Scherzo - Vivacissimo" war wirklich beeindruckend! Hier würde ich zu gern mal erleben, wie sich "Pop-Geiger" David Garrett, der sich ja gerne als schnellster (oder einer der schnellsten) Geigenspieler der Welt bezeichnet, hier schlagen würde… aber natürlich lässt sich ein Satz wie dieser von Prokofjew längst nicht so medienwirksam rüberbringen, wie der ewige Hummelflug :-)
Womit wir bei Rimski-Korsakow wären (von dem man hierzulande eigentlich viel zu selten etwas zu hören bekommt - ich denke allein an seine zahlreichen, fast alle um Märchengeschichten kreisenden Opern!)…
Er war - genau wie Maurice Ravel - ein genialer Instrumentator, der einem Orchester die faszinierendsten Klangfarben entlocken konnte!
Das Paradestück ist in diesem Bereich eindeutig seine gut 45-minütige "Scheherazade"-Suite für groß besetztes Sinfonieorchester (die gestern den zweiten Teil des Konzerts füllte) - in diesem dankbaren und ausgesprochen wirkungsvollen (und deswegen wohl auch so beliebten) orientalisch-märchenhaft angehauchten Orchesterstück kann ein gutes Orchester wirklich zeigen, was es alles drauf hat!
Und das Kölner Gürzenich-Orchester hatte einiges drauf: Ein sehr kraftvoller und runder, zugleich "knackiger" Ensembleklang - sehr präzise in den Tutti-Passagen, vor allem im vierten Satz, der mit seinen zahlreichen, oft völlig abrupten Wechseln von Motiven, Tempi und Klangfarben und der fast allgegenwärtigen Dominanz eines alles vorantreibenden Rhythmus stilistisch schon weit voraus ins 20. Jahrhundert weist!
Außerdem bietet diese Suite so ziemlich allen Instrumenten und Instrumentengruppen des Orchesters anspruchs- und wirkungsvolle Solostellen, sei es für die Blechbläser oder Solo-Fagott, -Oboe, -Klarinette, -Cello, etc. Von den stets wiederkehrenden Soli für die erste Violine (zumeist in aparter, exotisch-orientalisch wirkender Begleitung der Harfe) ganz zu schweigen! Eine dankbare Herausforderung für jeden Konzertmeister - in diesem Fall souverän gemeistert vom fabelhaften Torsten Janicke. Alles in allem also eine wirklich mitreißende und begeisternde Leistung des gesamten Ensembles unter dem Dirigat eines sich hier sichtlich in seinem Element befindlichen Emmanuel Krivine - an mehreren Stellen bekam man wirklich Gänsehaut und das ging sichtlich nicht nur mir so! Es hat sich wieder einmal wirklich gelohnt!
Auf dem Programm des insgesamt 8. Konzerts der laufenden Spielzeit standen folgende Werke:
Maurice Ravel (1875-1937)
"Ma Mère l'Oye" Suite für Orchester (1911)
Sergej Prokofjew (1891-1953)
Violinkonzert Nr. 1 D-Dur op. 19 (1916/17)
Nikolai Rimski-Korsakow (1844-1908)
Scheherazade op. 35
Sinfonische Suite aus "Tausendundeine Nacht" (1888)
Akiko Suwanai, Violine
Gürzenich-Orchester Köln
Dir.: Emmanuel Krivine
Alle drei Werke sind absolute Klassiker, die in den Jahren kurz vor und nach Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Die Zuhörer in der zu gut drei Viertel ausgebuchten Philharmonie konnten einen rundum gelungenen Konzertabend erleben mit einem engagierten Dirigenten, einer virtuosen Solistin und einem wirklich gut aufgelegten Orchester, so dass eigentlich keine Wünsche offen blieben!
Der französische Dirigent mit russisch-polnischen Wurzeln Emmanuel Krivine, der nach mehreren internationalen Stationen seit 2006 dem Philharmonischen Orchester Luxemburg vorsteht, fühlte sich begreiflicherweise neben dem französischen auch im russischen Repertoire des gestrigen Abends absolut heimisch und dirigierte den Prokofjew und den Rimski-Korsakow auswendig mit einem schwungvollen und dynamischen Stil - klare, weit ausholende Gesten, deren Entschlossenheit Musikern wie Publikum unmissverständlich vermittelte, dass sich der Maestro dieser Musik durch und durch verbunden fühlt!
Aber auch dem französischen Klangzauberer Ravel entlockte er zu Beginn in der kurzen fünfsätzigen "Mutter Gans"-Suite die erforderlichen klangprächtigen kindlich-fantasievollen Assoziationen, die zur Umsetzung der mit Märchenfiguren bevölkerten einzelnen Episoden erforderlich sind.
Die Violinistin Akiko Suwanai spielt auf einer Stradivari aus dem Jahr 1714, die sie als Leihgabe von der Nippon Music Foundation zur Verfügung gestellt bekommen hat. Es war wirklich beeindruckend zu erleben, welch raumfüllenden Klang dieses immerhin 300 Jahre alte Instrument besitzt - vor allem, als Akiko Suwanai als Zugabe nach dem bravourös absolvierten Prokofjew-Konzert eine kleine Solozugabe spielte (es handelte sich hierbei wohl um einen Satz aus einer der Partiten für Solovioline von Bach, in diesem Fall also um ein Stück, das genauso alt wie die Stradivari selber ist!): Der warme und klare Ton ihrer Geige drang mühelos noch in die letzte Ecke des riesigen Saales!
Aber auch zuvor hatte die Japanerin sich souverän über alle technischen Klippen des enorm schwierigen ersten Violinkonzerts von Prokofjew hinweggesetzt (die charakteristische "Violinentonart" D-Dur und die über weite Strecken sehr hoch geführte Solostimme hat dieses Konzert mit dem berühmten Beethoven-Konzert gemeinsam!) - allein schon der rasend schnelle Mittelsatz "Scherzo - Vivacissimo" war wirklich beeindruckend! Hier würde ich zu gern mal erleben, wie sich "Pop-Geiger" David Garrett, der sich ja gerne als schnellster (oder einer der schnellsten) Geigenspieler der Welt bezeichnet, hier schlagen würde… aber natürlich lässt sich ein Satz wie dieser von Prokofjew längst nicht so medienwirksam rüberbringen, wie der ewige Hummelflug :-)
Womit wir bei Rimski-Korsakow wären (von dem man hierzulande eigentlich viel zu selten etwas zu hören bekommt - ich denke allein an seine zahlreichen, fast alle um Märchengeschichten kreisenden Opern!)…
Er war - genau wie Maurice Ravel - ein genialer Instrumentator, der einem Orchester die faszinierendsten Klangfarben entlocken konnte!
Das Paradestück ist in diesem Bereich eindeutig seine gut 45-minütige "Scheherazade"-Suite für groß besetztes Sinfonieorchester (die gestern den zweiten Teil des Konzerts füllte) - in diesem dankbaren und ausgesprochen wirkungsvollen (und deswegen wohl auch so beliebten) orientalisch-märchenhaft angehauchten Orchesterstück kann ein gutes Orchester wirklich zeigen, was es alles drauf hat!
Und das Kölner Gürzenich-Orchester hatte einiges drauf: Ein sehr kraftvoller und runder, zugleich "knackiger" Ensembleklang - sehr präzise in den Tutti-Passagen, vor allem im vierten Satz, der mit seinen zahlreichen, oft völlig abrupten Wechseln von Motiven, Tempi und Klangfarben und der fast allgegenwärtigen Dominanz eines alles vorantreibenden Rhythmus stilistisch schon weit voraus ins 20. Jahrhundert weist!
Außerdem bietet diese Suite so ziemlich allen Instrumenten und Instrumentengruppen des Orchesters anspruchs- und wirkungsvolle Solostellen, sei es für die Blechbläser oder Solo-Fagott, -Oboe, -Klarinette, -Cello, etc. Von den stets wiederkehrenden Soli für die erste Violine (zumeist in aparter, exotisch-orientalisch wirkender Begleitung der Harfe) ganz zu schweigen! Eine dankbare Herausforderung für jeden Konzertmeister - in diesem Fall souverän gemeistert vom fabelhaften Torsten Janicke. Alles in allem also eine wirklich mitreißende und begeisternde Leistung des gesamten Ensembles unter dem Dirigat eines sich hier sichtlich in seinem Element befindlichen Emmanuel Krivine - an mehreren Stellen bekam man wirklich Gänsehaut und das ging sichtlich nicht nur mir so! Es hat sich wieder einmal wirklich gelohnt!
Freitag, 4. Februar 2011
Philharmonie-Konzert
Diese Woche Dienstag (01.02.11) bin ich überraschend noch ein weiteres Mal in den Genuss gekommen, nach dem Symphoniekonzert am 11. Januar nun auch noch das nächste Konzert des Kölner Gürzenich-Orchesters besuchen zu können.
Dieses 5. Symphoniekonzert der Spielzeit 2010/11 hatte folgendes Programm:
Hans Werner Henze (geb. 1926):
Elogium Musicum amatissimi amici nunc remoti (für gemischten Chor und Orchester)
Ludwig van Beethoven (1770-1827):
Symphonie Nr. 3 Es-Dur, op. 55 "Eroica"
Colin Matthews (geb. 1946):
Crossing the Alps (für gemischten Chor und Orgel)
MDR Rundfunkchor (Einstudierung Howard Arman)
Roderick Shaw, Orgel
Gürzenich-Orchester Köln
Dirigent: Markus Stenz
Das ungewöhnlich zusammengesetzte Programm dieses fast schon als halbes Chorkonzert zu bezeichnenden Symphoniekonzerts hat mich direkt neugierig gemacht, zumal es sich bei den beiden Chorwerken um ganz neue Kompositionen handelt: Henzes vierteiliges Stück, das einen lateinischen (meinem Empfinden nach etwas verquasten) Text von Franco Serpa als Grundlage hat, ist im Jahr 2008 entstanden, Colin Matthews' Komposition sogar erst 2009!
Während beim letzten Symphoniekonzert des Gürzenich-Orchesters im Januar das Orchester nach dem Beginn mit Mozart nach der Pause für die Schostakowitsch-Symphonie mächtig aufgerüstet wurde, schlug man diesmal den umgekehrten Weg ein:
Für das Henze-Werk waren noch mehr als 90 Musiker (plus Chor) erforderlich - inklusive einer reich besetzten Schlagwerk-Abteilung - für die Beethoven-Symphonie wurde dann im zweiten Konzertteil das Ganze auf die klassische Symphonieorchesterbesetzung (in diesem Fall ca. 50 Ausführende) "abgespeckt", der letzte Teil dieses Gürzenich-Orchester-Konzerts fand dann sogar ganz ohne selbiges statt: Nur der Chor und die Orgel waren im sogenannten "3. Akt" noch auf dem Podium zugange...
Das etwas sperrig betitelte Henze-Chorwerk "Elogium Musicum amatissimi amici nunc remoti" ("Lobgesang auf einen sehr geliebten Freund, der nun weit entfernt ist") ist anlässlich des Todes von Henzes langjährigem Lebensgefährten Fausto Ubaldo Moroni als eine Art Requiem entstanden. Fausto Moroni - 18 Jahre jünger als sein Freund Henze - war 2007 überraschend gestorben und Henze hat in dem viersätzigen, ca. 20-minütigen Werk für Chor und großes Orchester einen abwechslungsreichen Abschiedsgesang auf einen extra für diesen Anlass gedichteten lateinischen Text komponiert. Die Uraufführung fand im Oktober 2008 im Leipziger Gewandhaus statt, der mit dieser Uraufführung betraute Chor war ebenjener in Leipzig ansässige MDR Rundfunkchor, der - somit bestens mit diesem Werk vertraut - dieses Stück nun auch bei uns in Köln präsentieren durfte.
Ich fand Henzes Elogium nicht uninteressant, es gab einige wirklich anrührende Momente - im Großen und Ganzen fehlte mir aber etwas die - vielleicht aber vom Komponisten auch gar nicht beabsichtigte - große Linie in diesem ja nun auch nicht allzu langen Werk: Ständig wechselten Stimmung, Tempo, Besetzung, Lautstärke, am Ende bricht das Ganze sogar mitten in einer großen Steigerung ganz unvermittelt ab! Bei Markus Stenz war die Aufführung dieses Stücks in guten Händen - er pflegt langjährige künstlerische Kontakte zu Henze und hat auch mehrere Werke von ihm uraufgeführt.
Der eindeutige Höhepunkt des Konzerts war - und das gilt sicher nicht nur für mich - hingegen eindeutig die Aufführung von Ludwig van Beethovens symphonischem Meilenstein, seiner weltberühmten, "Eroica" betitelten 3. Symphonie!
Auch in dieser Symphonie geht es (und dies bildete wohl die sinnstiftende Kombination des Henze- mit dem Beethoven-Werk, die man auch im Rahmen der oben erwähnten Uraufführung im Oktober 2008 in Leipzig so gewählt hatte) um die Ehrung eines "großen Mannes", wie die Beethoven'sche Widmung nach der vielzitierten, im Zorn erfolgten Streichung der ursprünglichen Widmung des Werks an Napoléon Bonaparte nun stattdessen vielsagend lautete.
Markus Stenz interpretierte Beethovens Dritte ausgesprochen schwung- und temperamentvoll: Da klang nichts wuchtig und bedeutungsschwanger - im Gegenteil: Auch in seinen ausladenden Gesten beim Dirigieren betonte Stenz die ausgesprochen tänzerischen Elemente der Partitur, die gerade in den Ecksätzen (und im Scherzo) dem Ganzen eine wirklich absolut faszinierende und mitreißende Wirkung verliehen und Beethovens Genie (wieder einmal) eindrucksvoll erstrahlen ließen! Eine echte Sternstunde mit einem großartigen Orchester!
Wenn - wie am Dienstag - Markus Stenz "sein" Gürzenich-Orchester selber dirigiert, gibt es zum Abschluss des Konzerts regelmäßig den als "3. Akt" bezeichneten letzten Teil, dessen Besonderheit darin besteht, dass sein Programm immer erst unmittelbar vor dem Erklingen vom Maestro selbst dem Publikum bekanntgegeben wird.
Als deutsche Erstaufführung gab es nun also das ungefähr 7-minütige Chorstück "Crossing the Alps" des englischen Komponisten Colin Matthews, das als Auftragswerk für das Mahlerjahr 2010 entstanden war und vor fast genau einem Jahr, nämlich am 28. Januar 2010, in Manchester vom Hallé Choir unter der Leitung von Markus Stenz uraufgeführt wurde.
Vertont hat Matthews einen Text des Dichters William Wordsworth (1770-1850), in dem es nur vordergründig um eine Alpenüberquerung geht - eigentlich dreht sich alles um die menschliche Schaffens- und Erfindungsgabe, also erneut eine Art Lob des (kreativen und schöpferisch tätigen) Menschen - und damit wiederum eine irgendwie existente thematische Verbindung zu den beiden vorangegangenen Stücken dieses Konzertabends.
Von Matthews kannte ich bisher nur seinen symphonischen Satz "Pluto, the Renewer", der im Jahr 2000 die berühmte Suite "The Planets" von Gustav Holst (1874-1934) um den damals in Holsts Suite noch fehlenden Planeten ergänzte.
Matthews' Chorstück "Crossing the Alps" mit der sehr dezenten, sich nur im Bassbereich bewegenden Orgelbegleitung wirkt ausgesprochen ruhig und irgendwie geheimnisvoll - mich hat das Stück (ich bin ja eh ein Freund britischer Chormusik) wirklich neugierig gemacht auf weitere Werke dieses englischen Komponisten! Schade, dass es nur knapp 7 Minuten gedauert hat.
Immerhin konnte der MDR Rundfunkchor nach seinem eigentlich viel zu kurzen Einsatz im Henze-Werk hier noch einmal seine exzellente Intonation und seinen sehr homogenen Ensembleklang unter Beweis stellen.
Insgesamt also ein abwechslungsreicher und gelungener Konzertabend (eine gut 80%ige Auslastung der gut besuchten Kölner Philharmonie) mit ein paar überraschend neuen musikalischen Eindrücken und Begegnungen!
Dieses 5. Symphoniekonzert der Spielzeit 2010/11 hatte folgendes Programm:
Hans Werner Henze (geb. 1926):
Elogium Musicum amatissimi amici nunc remoti (für gemischten Chor und Orchester)
Ludwig van Beethoven (1770-1827):
Symphonie Nr. 3 Es-Dur, op. 55 "Eroica"
Colin Matthews (geb. 1946):
Crossing the Alps (für gemischten Chor und Orgel)
MDR Rundfunkchor (Einstudierung Howard Arman)
Roderick Shaw, Orgel
Gürzenich-Orchester Köln
Dirigent: Markus Stenz
Das ungewöhnlich zusammengesetzte Programm dieses fast schon als halbes Chorkonzert zu bezeichnenden Symphoniekonzerts hat mich direkt neugierig gemacht, zumal es sich bei den beiden Chorwerken um ganz neue Kompositionen handelt: Henzes vierteiliges Stück, das einen lateinischen (meinem Empfinden nach etwas verquasten) Text von Franco Serpa als Grundlage hat, ist im Jahr 2008 entstanden, Colin Matthews' Komposition sogar erst 2009!
Während beim letzten Symphoniekonzert des Gürzenich-Orchesters im Januar das Orchester nach dem Beginn mit Mozart nach der Pause für die Schostakowitsch-Symphonie mächtig aufgerüstet wurde, schlug man diesmal den umgekehrten Weg ein:
Für das Henze-Werk waren noch mehr als 90 Musiker (plus Chor) erforderlich - inklusive einer reich besetzten Schlagwerk-Abteilung - für die Beethoven-Symphonie wurde dann im zweiten Konzertteil das Ganze auf die klassische Symphonieorchesterbesetzung (in diesem Fall ca. 50 Ausführende) "abgespeckt", der letzte Teil dieses Gürzenich-Orchester-Konzerts fand dann sogar ganz ohne selbiges statt: Nur der Chor und die Orgel waren im sogenannten "3. Akt" noch auf dem Podium zugange...
Das etwas sperrig betitelte Henze-Chorwerk "Elogium Musicum amatissimi amici nunc remoti" ("Lobgesang auf einen sehr geliebten Freund, der nun weit entfernt ist") ist anlässlich des Todes von Henzes langjährigem Lebensgefährten Fausto Ubaldo Moroni als eine Art Requiem entstanden. Fausto Moroni - 18 Jahre jünger als sein Freund Henze - war 2007 überraschend gestorben und Henze hat in dem viersätzigen, ca. 20-minütigen Werk für Chor und großes Orchester einen abwechslungsreichen Abschiedsgesang auf einen extra für diesen Anlass gedichteten lateinischen Text komponiert. Die Uraufführung fand im Oktober 2008 im Leipziger Gewandhaus statt, der mit dieser Uraufführung betraute Chor war ebenjener in Leipzig ansässige MDR Rundfunkchor, der - somit bestens mit diesem Werk vertraut - dieses Stück nun auch bei uns in Köln präsentieren durfte.
Ich fand Henzes Elogium nicht uninteressant, es gab einige wirklich anrührende Momente - im Großen und Ganzen fehlte mir aber etwas die - vielleicht aber vom Komponisten auch gar nicht beabsichtigte - große Linie in diesem ja nun auch nicht allzu langen Werk: Ständig wechselten Stimmung, Tempo, Besetzung, Lautstärke, am Ende bricht das Ganze sogar mitten in einer großen Steigerung ganz unvermittelt ab! Bei Markus Stenz war die Aufführung dieses Stücks in guten Händen - er pflegt langjährige künstlerische Kontakte zu Henze und hat auch mehrere Werke von ihm uraufgeführt.
Der eindeutige Höhepunkt des Konzerts war - und das gilt sicher nicht nur für mich - hingegen eindeutig die Aufführung von Ludwig van Beethovens symphonischem Meilenstein, seiner weltberühmten, "Eroica" betitelten 3. Symphonie!
Auch in dieser Symphonie geht es (und dies bildete wohl die sinnstiftende Kombination des Henze- mit dem Beethoven-Werk, die man auch im Rahmen der oben erwähnten Uraufführung im Oktober 2008 in Leipzig so gewählt hatte) um die Ehrung eines "großen Mannes", wie die Beethoven'sche Widmung nach der vielzitierten, im Zorn erfolgten Streichung der ursprünglichen Widmung des Werks an Napoléon Bonaparte nun stattdessen vielsagend lautete.
Markus Stenz interpretierte Beethovens Dritte ausgesprochen schwung- und temperamentvoll: Da klang nichts wuchtig und bedeutungsschwanger - im Gegenteil: Auch in seinen ausladenden Gesten beim Dirigieren betonte Stenz die ausgesprochen tänzerischen Elemente der Partitur, die gerade in den Ecksätzen (und im Scherzo) dem Ganzen eine wirklich absolut faszinierende und mitreißende Wirkung verliehen und Beethovens Genie (wieder einmal) eindrucksvoll erstrahlen ließen! Eine echte Sternstunde mit einem großartigen Orchester!
Wenn - wie am Dienstag - Markus Stenz "sein" Gürzenich-Orchester selber dirigiert, gibt es zum Abschluss des Konzerts regelmäßig den als "3. Akt" bezeichneten letzten Teil, dessen Besonderheit darin besteht, dass sein Programm immer erst unmittelbar vor dem Erklingen vom Maestro selbst dem Publikum bekanntgegeben wird.
Als deutsche Erstaufführung gab es nun also das ungefähr 7-minütige Chorstück "Crossing the Alps" des englischen Komponisten Colin Matthews, das als Auftragswerk für das Mahlerjahr 2010 entstanden war und vor fast genau einem Jahr, nämlich am 28. Januar 2010, in Manchester vom Hallé Choir unter der Leitung von Markus Stenz uraufgeführt wurde.
Vertont hat Matthews einen Text des Dichters William Wordsworth (1770-1850), in dem es nur vordergründig um eine Alpenüberquerung geht - eigentlich dreht sich alles um die menschliche Schaffens- und Erfindungsgabe, also erneut eine Art Lob des (kreativen und schöpferisch tätigen) Menschen - und damit wiederum eine irgendwie existente thematische Verbindung zu den beiden vorangegangenen Stücken dieses Konzertabends.
Von Matthews kannte ich bisher nur seinen symphonischen Satz "Pluto, the Renewer", der im Jahr 2000 die berühmte Suite "The Planets" von Gustav Holst (1874-1934) um den damals in Holsts Suite noch fehlenden Planeten ergänzte.
Matthews' Chorstück "Crossing the Alps" mit der sehr dezenten, sich nur im Bassbereich bewegenden Orgelbegleitung wirkt ausgesprochen ruhig und irgendwie geheimnisvoll - mich hat das Stück (ich bin ja eh ein Freund britischer Chormusik) wirklich neugierig gemacht auf weitere Werke dieses englischen Komponisten! Schade, dass es nur knapp 7 Minuten gedauert hat.
Immerhin konnte der MDR Rundfunkchor nach seinem eigentlich viel zu kurzen Einsatz im Henze-Werk hier noch einmal seine exzellente Intonation und seinen sehr homogenen Ensembleklang unter Beweis stellen.
Insgesamt also ein abwechslungsreicher und gelungener Konzertabend (eine gut 80%ige Auslastung der gut besuchten Kölner Philharmonie) mit ein paar überraschend neuen musikalischen Eindrücken und Begegnungen!
Donnerstag, 13. Januar 2011
Philharmonie-Konzert
Da ich zufällig an eine Karte gekommen war, hatte ich Dienstagabend zum ersten Mal seit Monaten wieder mal Gelegenheit, ein Symphoniekonzert in der Kölner Philharmonie zu besuchen - da war ich seit über einem Jahr schon nicht mehr, da mein Fokus in der letzten Zeit neben den Orgelkonzerten ausschließlich auf Opernbesuche gerichtet war - das sollte ich vielleicht bald mal wieder ändern...
Im Rahmen der Symphoniekonzerte des Kölner Gürzenich-Orchesters gab es am Dienstag folgendes Programm - ganz in d-moll - zu erleben:
W. A. Mozart (1756-91): Klavierkonzert Nr. 20 d-moll KV 466
Dmitri Schostakowitsch (1906-75): Symphonie Nr. 5 d-moll, op. 47
Antti Siirala (Klavier)
Gürzenich-Orchester Köln
Dirigent: Michael Sanderling
Über das Mozart-Konzert habe ich mich sehr gefreut, denn unter seinen knapp 30 Klavierkonzerten ist mir das mit der heute üblichen Nummer 20 mit seinem unruhig-dramatisch-leidenschaftlichen Grundton das Liebste!
Die ca. 30 Orchestermusiker begleiteten den 31-jährigen Finnen Antti Siirala auf modernen Instrumenten, Michael Sanderling (den ich 2003 als Leiter des Deutschen Musikschulorchesters kennengelernt habe) verstand es aber trotzdem, einen weitgehend transparenten Klang und einen federnden, flotten Grundrhythmus entstehen zu lassen, der gut zu dem Werk passte.
Ich finde es gut, dass auch "traditionelle" Symphonieorchester nach wie vor Musik der Wiener Klassik (hier vor allem die von Haydn und Mozart) spielen und diese Epoche den auf historischem Instrumentarium spielenden Spezialensembles nicht alleine überlassen (obwohl man schon merkt, dass diese Musik heute seltener von Symphonieorchestern aufgeführt wird als noch vor 25 oder 30 Jahren).
Passend zum modernen Instrumentarium erklang der Klavierpart des Konzerts dann auch vom großen Steinway-Flügel, wobei auch der Solist darum bemüht war, einen möglichst entschlackten und klaren Ton zu erzeugen und das Ganze nicht in üppige (spät-)romantische Klangkaskaden einzupacken.
Sehr schön fand ich auch, dass es die beiden Solokadenzen zu hören gab, die Ludwig van Beethoven für den ersten und dritten Satz dieses Konzerts verfasst hat - die klingen typisch nach dem großen Bonner und passen stilistisch nicht wirklich zum Rest des Konzerts, sind aber sehr ausdrucksstark und es gibt jeweils herrliche Steigerungen zum Ende hin!
Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass der Solist sich vom Tonfall her in dieser Beethoven-Klangwelt wohler fühlte, als im etwas zurückhaltenderen Mozart-Idiom.
Eine etwa fünfminütige Solozugabe, die Siirala nach Beendigung des Klavierkonzerts noch zum Besten gab (es müsste ein Stück von Brahms gewesen sein, genauer kann ich es leider nicht sagen...?), bestätigte meinen Eindruck, dass er sich in der Ausdruckswelt der Klaviermusik des 19. Jahrhunderts wohl doch wohler fühlen dürfte als im späten 18. Jahrhundert - der tiefgründig-romantische Tonfall liegt ihm definitv!
Nach der Pause gab es dann das Gürzenich-Orchester quasi in Vollbesetzung zu erleben, denn für die Schostakowitsch-Symphonie wurde die Orchesterbesetzung gegenüber dem Mozart-Konzert mehr als verdoppelt: Ca. 80 Musiker und Musikerinnen betätigten sich in den kommenden gut 50 Minuten auf der Bühne und es gab neben dem Hören der ausgesprochen dankbaren 5. Symphonie nun auch eine Menge zu sehen: Allein die reich besetzte "Schießbude" - wie Orchestermusiker die Schlagwerkabteilung nennen - war ein Erlebnis, dazu dann noch zwei Harfen, ein Flügel (in dieser Symphonie allerdings nur passagenweise zur Klangverstärkung vorgesehen), eine Celesta, jeeede Menge Bläser und ein üppig besetztes Streichensemble (allein acht Kontrabässe!) gaben eine wirklich beeindruckende Kulisse ab!
Und der Klang eines derart ausgestatteten Symphonieorchesters an den lauten wie auch den leisen Stellen ist live immer wieder ein echtes Erlebnis - da kommt einfach keine noch so gute Musikkonserve mit! Schön, dass ich sowas mal wieder erleben durfte.
Michael Sanderlings dynamisches und energiegeladenes Dirigat sorgte für eine mitreißende Wiedergabe dieser Schostakowitsch-Symphonie - die Interpretation hat mir (wie offensichtlich auch dem Rest des Publikums in der zu gut 70 % ausgelasteten Philharmonie) wirklich sehr gut gefallen - ich werde mich demnächst wohl mal wieder etwas intensiver mit Schostakowitsch beschäftigen... ;-)
Im Rahmen der Symphoniekonzerte des Kölner Gürzenich-Orchesters gab es am Dienstag folgendes Programm - ganz in d-moll - zu erleben:
W. A. Mozart (1756-91): Klavierkonzert Nr. 20 d-moll KV 466
Dmitri Schostakowitsch (1906-75): Symphonie Nr. 5 d-moll, op. 47
Antti Siirala (Klavier)
Gürzenich-Orchester Köln
Dirigent: Michael Sanderling
Über das Mozart-Konzert habe ich mich sehr gefreut, denn unter seinen knapp 30 Klavierkonzerten ist mir das mit der heute üblichen Nummer 20 mit seinem unruhig-dramatisch-leidenschaftlichen Grundton das Liebste!
Die ca. 30 Orchestermusiker begleiteten den 31-jährigen Finnen Antti Siirala auf modernen Instrumenten, Michael Sanderling (den ich 2003 als Leiter des Deutschen Musikschulorchesters kennengelernt habe) verstand es aber trotzdem, einen weitgehend transparenten Klang und einen federnden, flotten Grundrhythmus entstehen zu lassen, der gut zu dem Werk passte.
Ich finde es gut, dass auch "traditionelle" Symphonieorchester nach wie vor Musik der Wiener Klassik (hier vor allem die von Haydn und Mozart) spielen und diese Epoche den auf historischem Instrumentarium spielenden Spezialensembles nicht alleine überlassen (obwohl man schon merkt, dass diese Musik heute seltener von Symphonieorchestern aufgeführt wird als noch vor 25 oder 30 Jahren).
Passend zum modernen Instrumentarium erklang der Klavierpart des Konzerts dann auch vom großen Steinway-Flügel, wobei auch der Solist darum bemüht war, einen möglichst entschlackten und klaren Ton zu erzeugen und das Ganze nicht in üppige (spät-)romantische Klangkaskaden einzupacken.
Sehr schön fand ich auch, dass es die beiden Solokadenzen zu hören gab, die Ludwig van Beethoven für den ersten und dritten Satz dieses Konzerts verfasst hat - die klingen typisch nach dem großen Bonner und passen stilistisch nicht wirklich zum Rest des Konzerts, sind aber sehr ausdrucksstark und es gibt jeweils herrliche Steigerungen zum Ende hin!
Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass der Solist sich vom Tonfall her in dieser Beethoven-Klangwelt wohler fühlte, als im etwas zurückhaltenderen Mozart-Idiom.
Eine etwa fünfminütige Solozugabe, die Siirala nach Beendigung des Klavierkonzerts noch zum Besten gab (es müsste ein Stück von Brahms gewesen sein, genauer kann ich es leider nicht sagen...?), bestätigte meinen Eindruck, dass er sich in der Ausdruckswelt der Klaviermusik des 19. Jahrhunderts wohl doch wohler fühlen dürfte als im späten 18. Jahrhundert - der tiefgründig-romantische Tonfall liegt ihm definitv!
Nach der Pause gab es dann das Gürzenich-Orchester quasi in Vollbesetzung zu erleben, denn für die Schostakowitsch-Symphonie wurde die Orchesterbesetzung gegenüber dem Mozart-Konzert mehr als verdoppelt: Ca. 80 Musiker und Musikerinnen betätigten sich in den kommenden gut 50 Minuten auf der Bühne und es gab neben dem Hören der ausgesprochen dankbaren 5. Symphonie nun auch eine Menge zu sehen: Allein die reich besetzte "Schießbude" - wie Orchestermusiker die Schlagwerkabteilung nennen - war ein Erlebnis, dazu dann noch zwei Harfen, ein Flügel (in dieser Symphonie allerdings nur passagenweise zur Klangverstärkung vorgesehen), eine Celesta, jeeede Menge Bläser und ein üppig besetztes Streichensemble (allein acht Kontrabässe!) gaben eine wirklich beeindruckende Kulisse ab!
Und der Klang eines derart ausgestatteten Symphonieorchesters an den lauten wie auch den leisen Stellen ist live immer wieder ein echtes Erlebnis - da kommt einfach keine noch so gute Musikkonserve mit! Schön, dass ich sowas mal wieder erleben durfte.
Michael Sanderlings dynamisches und energiegeladenes Dirigat sorgte für eine mitreißende Wiedergabe dieser Schostakowitsch-Symphonie - die Interpretation hat mir (wie offensichtlich auch dem Rest des Publikums in der zu gut 70 % ausgelasteten Philharmonie) wirklich sehr gut gefallen - ich werde mich demnächst wohl mal wieder etwas intensiver mit Schostakowitsch beschäftigen... ;-)
Abonnieren
Posts (Atom)